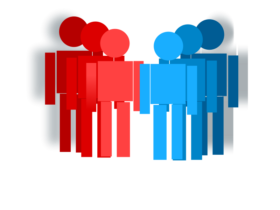Bild von musikschule auf Pixabay
Bei der zweiten Entscheidung, die ich vorstelle, handelt es sich um den OLG Dresden, Beschl. v. 26.10.2023 – 3 Ws 66/23. Vorab: Der Beschluss ist im „Grünes-Gewölbe-Verfahren“ ergangen. Das OLG Dresden hat in der Entscheidung noch einmal Stellung zur zusätzlichen Verfahrensgebühr Nr. 4142 VV im Fall der Einziehung, wobei Fragen der Berechnung des Gegenstandswertes im Vordergrund gestanden haben.
In dem Verfahren hatte die StA un der vom LG unverändert zugelassenen Anklageschrift u.a. auch beantragt, gemäß §§ 73, 73 c StGB die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 113.800.000,00 EUR gegen die Angeklagten als Gesamtschuldner anzuordnen. Das LG hat das Verfahren über die Einziehung von Wertersatz abgetrennt, im Übrigen aber die Angeklagten zum Teil zu Haftstrafen verurteilt, ein Angeklagter ist freigesprochen worden. Nach Einreichung eines Kostenfestsetzungsantrages durch die Verteidiger des Freigesprochenen hat der Bezirksrevisor beim LG die Festsetzung des Gegenstandswertes für das Einziehungsverfahren beantragt. Das LG hat den Gegenstandswert gemäß § 33 RVG auf 113.800.00,00 EUR festgesetzt.
Dagegen richtet sich die Beschwerde des Bezirksrevisors. Er ist der Auffassung der Gegenstandswert sei zum einen kopfteilig auf die Angeklagten aufzuteilen. Zum anderen sei zu berücksichtigen, dass die Angeklagten wirtschaftlich nicht leistungsfähig seien. Das Rechtsmittel hatte keinen Erfolg.
Das OLG führt aus:
„Die gemäß § 33 Abs. 3 RVG zulässige und fristgerecht eingelegte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.
Nach Nr. 4142 des Vergütungsverzeichnisses zum RVG (VV) fällt eine besondere Verfahrensgebühr als Wertgebühr an, wenn der Rechtsanwalt eine auf die Einziehung und verwandte Maßnahmen bezogene gerichtliche oder außergerichtliche Tätigkeit für den Beschuldigten ausübt (BGH, Beschluss vom 29. November 2018, 3 StR 625/17 – juris). Die Verfahrensgebühr wird auch durch eine bloß beratende Tätigkeit des Rechtsanwalts ausgelöst. Erforderlich, aber auch ausreichend für das Entstehen der zusätzlichen Gebühr ist eine nach Aktenlage gebotene Beratung des Mandanten. Das wird immer der Fall sein, wenn Fragen der Einziehung nahe liegen. Es kommt weder darauf an, ob der Erlass der Maßnahme rechtlich zulässig -. ist, noch, ob es an einer gerichtlichen Entscheidung über die Einziehung fehlt, noch ist erforderlich, dass die Einziehung ausdrücklich beantragt worden ist. Es genügt, dass sie nach Lage der Sache ernsthaft in Betracht kommt (OLG Dresden, Beschluss vom 14. Februar 2020, 1 Ws 40/20 – juris).
Der Gegenstandswert bemisst sich dabei nach dem wirtschaftlichen Interesse der Angeklagten auf die Abwehr der Einziehung. Maßgeblich ist – wie bei Festsetzung der Kosten im Zivilprozess – der Nominalwert der titulierten Einziehungsforderung. Eine Verringerung des Gegenstandswertes wegen fehlender Durchsetzbarkeit des Zahlungsanspruches ist generell weder im Streitwert- noch Kostenfestsetzungsverfahren vorgesehen. Es kommt daher nicht darauf an, dass wegen der (vermuteten) Vermögenslosigkeit der Angeklagten erhebliche Zweifel an der Werthaltigkeit der Einziehungsforderung bestehen (vgl. BGH, Beschluss vom 22.05.2019, 1 StR 471/18 – juris; BGH, Beschluss vom 29.06.2020, 1 StR 1/20 – juris).
Für eine Festsetzung des Gegenstandswertes nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Angeklagten fehlt es im Übrigen auch an objektiv nachvollziehbaren, allgemein gültigen Kriterien, was letztlich zu willkürlichen Festlegungen führen würde. Das alleinige Abstellen auf den Gegenstandswert für die Berechnung der Gebühr nach Nr. 4142 VV-RVG könne im Einzelfall zu ungerechtfertigt hohen Ansprüchen führen, hier korrigierend einzugreifen bleibe aber dem Gesetzgeber überlassen (so schon BGH NStZ 2007, 341). Bei der Feststellung des Gegenstandswertes kommt es des Weiteren auch nicht auf die Anzahl der Täter und das wirtschaftliche Interesse jedes einzelnen Täters an der Abwendung der Einziehung an. Das subjektive Interesse des Täters bleibt bei der Bestimmung des objektiven Verkehrswertes einer Sache im Rahmen der Nr. 4142 VV-RVG außer Betracht. Deshalb kann bei mehreren Tätern auch nicht der auf einen Täter fallende Anteil an der Beute, bzw. dessen Wert, für die Bestimmung des objektiven Verkehrswertes maßgebend sein (OLG Bamberg, JurBüro 2007, 201). Die Angeklagten haften im Übrigen hinsichtlich der Einziehungsforderung auch gesamtschuldnerisch.“
Anzumerken ist: Das OLG hat die aufgeworfenen Fragen, bei denen es vor allem um die Höhe des Gegenstandswertes ging, zutreffend auf der Grundlage der dazu vorliegenden Rechtsprechung und Literatur gelöst (vgl. die Zusammenstellung bei Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG Straf- und Bußgeldsachen, 6. Aufl. 2021, Nr. 4142 VV Rn 29 ff.). Dem ist nichts hinzuzufügen, außer:
Aus Sicht der Staatskasse ist das Bemühen, den Gegenstandswert möglichst gering zu halten, nachvollziehbar, wobei mal allerdings nicht verkennen sollte, dass es die Staatsanwaltschaft ist/war, die sich für das Land Sachsen eines Einziehungsanspruchs in Höhe von 113.800.000,00 EUR berühmt hat. Und es gilt nun mal der Grundsatz: Wer die Musik – hier die Einziehung – bestellt, der muss sie auch bezahlen. Und zu bezahlen ist hier ggf. einiges. Nicht unbedingt an gesetzliche Gebühren der Pflichtverteidiger. Denn insoweit „rettet“ die Staatskasse die sich aus § 49 RVG ergebende Beschränkung der Gegenstandswertes auf 50.000 EUR. Aber: Bei dem Freigesprochenen dürfte sich ein weitaus höherer Betrag ergeben. Denn im Rahmen der Kostenerstattung sind auch die Gebühren nach Nr. 4142 VV RVG zu erstatten. Zu erstatten sind die der Höhe nach nach der Tabelle zu 13 RVG, also ohne Beschränkung aus § 49 RVG (Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Nr. 4142 VV Rn 40), aber immerhin mit der aus § 22 Abs. 2 S. 1 RVG auf 30.000.000,00 EUR. Da nach Nr. 4142 Anm. 3 VV RVG zwei Gebühren – erster Rechtszug und im Zweifel Rechtsmittelverfahren -angefallen sein dürften, dürfte es hier um erhebliche Beträge gehen, die das Rechtsmittel der Staatskasse gegen die zutreffende Festsetzung des Gegenstandswertes durch das LG verständlich machen.