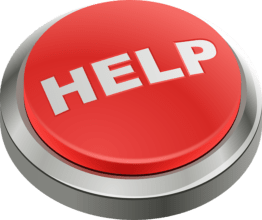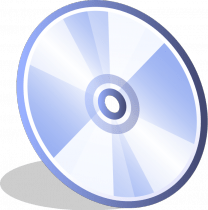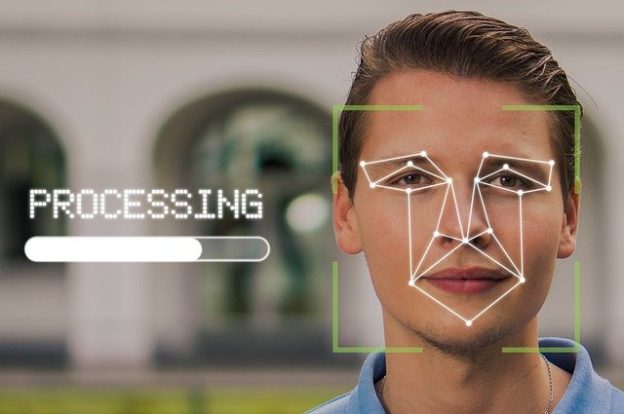Und dann mal wieder drei Entscheidungen zur Beweiswürdigung.
Ich starte mit dem BGH, Beschl. v. 18.03.2021 – 4 StR 480/20. Das ist mal wieder einer der Beschlüsse, mit denen der BGH einer Strafkammer die Leviten liest = die Beweiswürdigung als zu lang beanstandet. Für mich sind das immer „Hilferufbeschlüsse“ des BGH, der ja das, was die Strafkammern schreiben – hier war es eine des LG Dortmund – alles lesen muss.
So auch hier. Verurteilt worden ist der Angeklagte bei Freisprechung im Übrigen wegen besonders schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, sexuellem Missbrauch eines Kindes und mit der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Die Revision des Angeklagten hatte Erfolg. Die Beweiswürdigung des LG begegnet nach Auffassung des BGH rechtlichen Bedenken.
Zunächst mahnt der BGH/ruft um Hilfe:
„1. Die Beweiswürdigung ist Sache des Tatgerichts (§ 261 StPO). Ihm allein obliegt es, sich unter dem umfassenden Eindruck der Hauptverhandlung ein Urteil über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten zu bilden. Seine Schlussfolgerungen brauchen nicht zwingend zu sein; es genügt, dass sie möglich sind. Die revisionsgerichtliche Prüfung ist darauf beschränkt, ob dem Tatgericht bei der Beweiswürdigung Rechtsfehler unterlaufen sind. Dies ist in sachlichrechtlicher Hinsicht unter anderem der Fall, wenn die Beweiswürdigung widersprüchlich, unklar oder lückenhaft ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteile vom 14. Januar 2021 – 3 StR 124/20, NStZ-RR 2021, 113, 114 und vom 30. Juli 2020 – 4 StR 603/19, NStZ 2021, 116, 117; Beschluss vom 6. August 2020 – 1 StR 178/20, NStZ 2021, 184, 185).
Das Tatgericht ist gemäß §§ 261, 267 StPO verpflichtet, in den Urteilsgründen darzulegen, dass seine Überzeugung auf einer umfassenden, von rational nachvollziehbaren Erwägungen bestimmten Beweiswürdigung beruht (vgl. BGH, Beschlüsse vom 18. November 2020 – 2 StR 152/20 und vom 11. März 2020 – 2 StR 380/19, NStZ-RR 2020, 258; MüKo-StPO/Miebach, 1. Aufl., § 261 Rn. 114). Die wesentlichen Beweiserwägungen sind in den schriftlichen Urteilsgründen so darzulegen, dass die tatgerichtliche Überzeugungsbildung für das Revisionsgericht nachzuvollziehen und auf Rechtsfehler hin zu überprüfen ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschlüsse vom 18. November 2020 – 2 StR 152/20, Rn. 6 und vom 25. Februar 2015 – 4 StR 39/15; Urteil vom 7. August 2014 – 3 StR 224/14). Im Falle der Verurteilung des Angeklagten ist das Tatgericht grundsätzlich verpflichtet, die für den Schuldspruch wesentlichen Beweismittel im Rahmen seiner Beweiswürdigung heranzuziehen und einer erschöpfenden Würdigung zu unterziehen (vgl. BGH, Beschluss vom 25. Februar 2015 – 4 StR 39/15, Rn. 3).
Die schriftlichen Urteilsgründe dienen jedoch nicht dazu, den Ablauf der Ermittlungen oder den Gang der Hauptverhandlung in allen Einzelheiten zu dokumentieren. Es ist deshalb in der Regel weder erforderlich noch empfehlenswert, in den Urteilsgründen im Einzelnen wiederzugeben, welche Ergebnisse die im Hauptverhandlungsprotokoll verzeichneten Beweiserhebungen erbracht haben.
Es ist deshalb regelmäßig überflüssig, nach den tatsächlichen Feststellungen sämtliche in der Hauptverhandlung erhobenen Beweismittel, auf denen das Urteil beruhen soll, aufzuzählen; erforderlich ist regelmäßig auch nicht, den wesentlichen Inhalt von Zeugenaussagen ‒ wie im angefochtenen Urteil auf über 50 Seiten geschehen ‒ losgelöst von ihrer Beweisbedeutung in chronologischer Reihenfolge in allen Einzelheiten wiederzugeben. Eine bloße Wiedergabe der Zeugenaussagen ersetzt nicht ihre eigenverantwortliche Würdigung und kann den Bestand des Urteils gefährden (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschlüsse vom 13. Mai 2020 – 2 StR 367/19 und vom 17. Oktober 1996 – 1 StR 614/96). Eine breite Darstellung der Zeugenaussagen kann schließlich die Anforderungen an eine erschöpfende Würdigung aller für und gegen die Glaubhaftigkeit der Zeugenaussage sprechenden Umstände erhöhen, wenn die mitgeteilten Einzelheiten Anlass bieten, die tatgerichtlichen Wertungen in Frage zu stellen.“
Und dann – trotz der Überlänge:
„2. Gemessen hieran halten die tatgerichtlichen Beweiserwägungen einer rechtlichen Überprüfung nicht stand. Sie sind lückenhaft.
Das Landgericht hat seine Überzeugung, dass es der Angeklagte war, der dem Tatopfer unter anderem eine leere Bierflasche aus Glas sowie einen Besenstiel jeweils „zumindest einige Zentimeter in die Vagina schob“, maßgeblich auf die Angaben des zur Tatzeit 13 Jahre alten Zeugen N. gestützt.
a) Das Landgericht hat die Aussage des Zeugen N. in der Hauptverhandlung im Einzelnen und unter Hervorhebung seiner im Zusammenhang sowie auf Fragen des Gerichts erfolgten Angaben (UA S. 56 bis 64), seine Erstangaben gegenüber einem Erzieher und seine Angaben im Verlaufe der Ermittlungen in den Urteilsgründen wiedergegeben (vgl. UA S. 64 bis 75). Im Rahmen der an späterer Stelle aufgenommenen – knappen – Beweiserwägungen hat das Landgericht seine Überzeugung von der Glaubhaftigkeit seiner Angaben unter anderem auf ein fehlendes Falschbelastungsmotiv sowie auf die Aussagekonstanz gestützt. Die diese Wertung tragenden Beweiserwägungen sind lückenhaft und nicht nachvollziehbar.
aa) Das Landgericht hat ein Falschbelastungsmotiv des Zeugen mit der Begründung verneint, es lägen keine Anhaltpunkte dafür vor, dass der Zeuge eigene Handlungen habe vertuschen wollen; soweit das Tatopfer den Zeugen bezichtigt habe, dass er selbst es mit dem Besenstiel penetriert habe, „dürfte“ der Zeuge von dieser Aussage keine Kenntnis erlangt haben, so dass diese Aussage als Anlass für ein Falschbelastungsmotiv ausscheide.
Es bedarf keiner Entscheidung, ob diese tatgerichtlichen Beweiserwägungen bereits deshalb durchgreifenden rechtlichen Bedenken begegnen, weil es diesem Umstand jede Beweisbedeutung mit der nicht tatsachengestützten Vermutung fehlender Kenntnis des Zeugen hiervon abgesprochen hat.
Die tatgerichtlichen Beweiserwägungen zu einem fehlenden Falschbelastungsmotiv lassen jedenfalls nicht erkennen, dass das Landgericht berücksichtigt hat, dass ein Falschbelastungsmotiv nicht oder nicht allein in der belastenden Aussage des Tatopfers, sondern in einer möglichen eigenen Tatbeteiligung des Zeugen wurzeln kann. Hätte der Zeuge N. das Geschehen zum Nachteil der Nebenklägerin nicht – wie festgestellt – als unbeteiligter Dritter beobachtet, sondern wäre er als Beteiligter selbst in das Tatgeschehen verstrickt gewesen (vgl. Miebach, NStZ-RR 2021, 33, 34; Wenske in MüKo-StPO, 1. Aufl., § 267 Rn. 212), läge hierin ein mögliches Motiv für eine Falschbelastung und seine Aussage bedürfte einer besonders kritischen Würdigung, an der es hier fehlt.
Darüber hinaus hätte Anlass zur Prüfung eines möglichen Falschbelastungsmotivs auch unter dem Gesichtspunkt bestanden, dass der Zeuge N. ausweislich seiner in den Urteilsgründen dokumentierten Angaben gegenüber einem Erzieher, dem Zeugen R. , bekundete, dass „alle anwesenden Personen […], auch er selbst“ an dem Tatgeschehen zum Nachteil der Nebenklägerin beteiligt gewesen seien und auch er selbst das Tatopfer „geschlagen und getreten“ habe. Hieran fehlt es……“