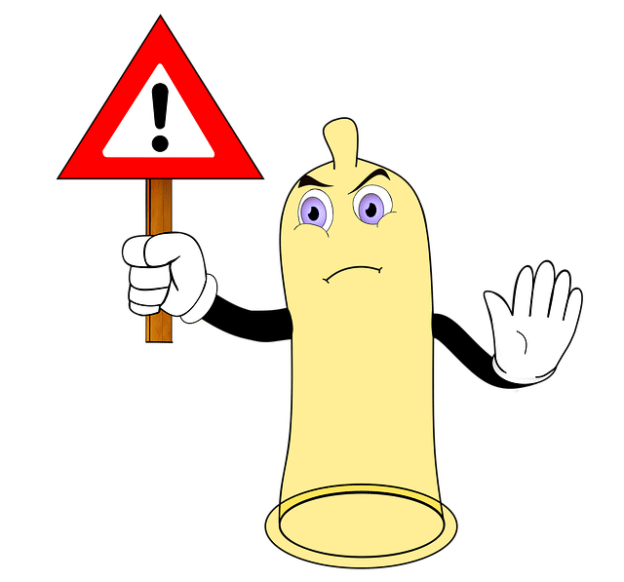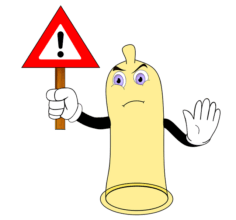Der heutige Mittwoch ist dann drei StGB-Entscheidungen gewidmet,
Ich beginne mit dem OLG Hamm, Urt. v. 01.03.2022 – 5 RVs 124/21. In dem Verfahren, das schon ein wenig länger andauert, geht es um einen Vergewaltigungsvorwurf.
Das AG hatte den Angeklagten zunächst am 06.05.2019 wegen Vergewaltigung und wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Gegen dieses Urteil haben Verteidigung und Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Mit Urteil vom 02.04.2020 hat das LG das angefochtene Urteil auf die Berufung der Staatsanwaltschaft dahingehend abgeändert, dass der Angeklagte wegen Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt wird. Zugleich hat es die Berufung des Angeklagten verworfen.
Auf die Revision des Angeklagten hat dann das OLG Hamm mit Beschluss vom 01.09.2020 das LG-Urteil mit den zugrundeliegenden Feststellungen aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Im zweiten Durchgang hat das LG dann das Urteil des Amtsgerichts vom 06.05.2019 auf die Berufung des Angeklagten dahingehend abgeändert, dass der Angeklagte wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen verurteilt bleibt und ihn hinsichtlich der ihm durch die Anklage zur Last gelegten Vergewaltigung freigesprochen.
Hinsichtlich des Vergewaltigungsvorwurfs hat das LG festgestellt, dass der Angeklagte und die Nebenklägerin sich in den Wochen vor dem angeklagten Vorfall mehrfach, aber nie endgültig getrennt hatten. Nach einer Geburtstagsfeier bei einem Zeugen übernachteten der Angeklagte und die Geschädigte im Schlafzimmer von dessen Wohnung. Im Bett fing der Angeklagte an, sexuelle Handlungen mit der Geschädigten vorzunehmen, wobei unklar geblieben ist, wie genau er diese initiierte und wie die Geschädigte hierauf eingangs reagierte. Der Angeklagte vollzog sodann mit der Nebenklägerin den vaginalen Geschlechtsverkehr bis zum Samenerguss. Hierüber geriet die Nebenklägerin in Wut, da zwischen beiden abgesprochen war, dass der Angeklagte entweder mit einem Kondom den Geschlechtsverkehr bis zum Samenerguss vollziehen dürfe oder sie oder er geeignete Mittel zur Verhinderung einer Schwangerschaft ergreifen sollten. Konkret benutzte die Geschädigte zur Verhütung entweder einen Vaginalring oder der Angeklagte zog den Penis aus der Vagina, bevor es zum Samenerguss kam.
Gegen diesen Freispruch hat dann die Nebenklägerin Revision eingelegt. Und die hatte – erneut – Erfolg:
„a) Zu Recht beanstanden Nebenklage und Generalstaatswaltschaft, dass das Landgericht den Unrechtsgehalt der Tat nicht ausgeschöpft hat und somit seiner Kognitionspflicht (§ 264 StPO) nicht ausreichend nachgekommen ist. Nach den – allerdings nicht rechtsfehlerfrei (dazu unter c)) – getroffenen Feststellungen hat der Angeklagte den objektiven Tatbestand des sexuellen Übergriffs (§ 177 Abs. 1 StGB) verwirklicht.
aa) Durch § 177 Abs. 1 StGB in der seit dem 10.11.2016 geltenden Fassung wird das Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung durch die sogenannte „Nein-heißt-Nein-Lösung“ umfassend, d.h. unabhängig von einem Nötigungselement geschützt (BT-Drs. 18/9097 S. 21 ff.). Wegen sexuellen Übergriffs macht sich dementsprechend unter anderem strafbar, wer an einer anderen Person gegen deren erkennbaren Willen sexuelle Handlungen vornimmt. Anknüpfungspunkt für die Strafbarkeit ist dabei – wie sich aus den Gesetzesmaterialien (BT-Drs. 18/9097 S. 23) sowie der systematischen Zusammenschau mit Abs. 2 (OLG Schleswig, Urteil vom 19.03.2021 – 2 OLG 4 Ss 13/21 -, Rn. 22, juris; Renzikowski, in: MünchKomm, 4. Aufl. 2021, § 177 StGB Rn. 50) ergibt – nicht der rechtsgeschäftliche, sondern der natürliche Wille des Opfers. Willensbedingte Mängel hindern ein tatbestandsausschließendes Einverständnis daher auch dann nicht, wenn das Einverständnis des Opfers durch Täuschung erschlichen wurde (Ziegler, in: Beck´scherOK, Stand: 01.11.2021, StGB § 177 Rn. 1, Eisele, in: Schönke/Schröder, 30. Aufl. 2019, StGB § 177 Rn. 20). Erforderlich, aber auch ausreichend für das Einverständnis ist, dass die betroffene Person die sexuelle Bedeutung der entsprechenden sexuellen Handlung kennt (Renzikowski, in: MünchKomm, a.a.O., § 177 StGB Rn. 50). Lehnt das Opfer die sexuelle Handlung hingegen ab, ist es gleichgültig aus welchen Gründen sie dies tut (Ziegler, in: Beck´scherOK, a.a.O., § 177 Rn. 11).
bb) Ausgehend von den soeben dargelegten Grundsätzen wurde die hier maßgebliche Frage, unter welchen Voraussetzungen ein tatbestandsausschließendes Einverständnis des Opfers anzunehmen ist, in der letzten Zeit intensiv bezüglich des heimlichen Abziehens des Kondoms während des Geschlechtsverkehrs (sog. „Stealthing“) diskutiert. Die mit dieser Fragestellung befassten Obergerichte – KG Berlin (Beschluss vom 27.07.2020 – (4) 161 Ss 48/20 (58/20) -, juris); OLG Schleswig (Urteil vom 19.03.2021 – 2 OLG 4 Ss 13/21 -, Rn. 22, juris); Bayerisches Oberstes Landesgericht (Beschluss vom 20.08.2021 – 206 StRR 87/21 -, juris) – sind der herrschenden Meinung (s. die Nachweise bei Bayerisches Oberstes Landesgericht, Beschluss vom 20.08.2021 – 206 StRR 87/21 -, juris) gefolgt und haben einheitlich und mit überzeugender Begründung die Strafbarkeit des „Stealthing“ nach § 177 Abs. 1 StGB jedenfalls dann bejaht, wenn der Täter in den Körper des Opfers absprachewidrig ejakuliert.
cc) Die in den vorgenannten Entscheidungen aufgestellten Maßstäbe können auch vorliegend herangezogen werden. Danach ist davon auszugehen, dass das von § 177 StGB geschützte Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung die Freiheit der Person beinhaltet, über Zeitpunkt, Art, Form und Partner sexueller Betätigung nach eigenem Belieben zu entscheiden (KG Berlin, Beschluss vom 27.07.2020 – (4) 161 Ss 48/20 (58/20) -, Rn. 22, juris). Nach dem Schutzzweck der Norm kann der Rechtsgutinhaber daher nicht nur darüber bestimmen, ob überhaupt Geschlechtsverkehr stattfinden soll, sondern auch darüber, unter welchen Voraussetzungen er mit einer sexuellen Handlung einverstanden ist (KG Berlin, Beschluss vom 27. Juli 2020 – (4) 161 Ss 48/20 (58/20) -, Rn. 22, juris). Somit kann sich das Einvernehmen des Sexualpartners konkret sehr wohl nur auf bestimmte sexuelle Handlungen – beispielsweise Geschlechtsverkehr ausschließlich unter Verwendung eines Kondoms – beziehen, während gleichzeitig anderen sexuellen Handlungen ein erkennbarer Wille entgegenstehen kann (OLG Schleswig, Urteil vom 19. März 2021 – 2 OLG 4 Ss 13/21 -, Rn. 16, juris).
In der vorliegenden Fallgestaltung ist hierbei insbesondere von Bedeutung, dass dem Samenerguss in der Vagina in sexualstrafrechtlicher Hinsicht eine andere Handlungsqualität als der „bloßen“ vaginalen Penetration zukommt (KG Berlin, Beschluss vom 27.07.2020 – (4) 161 Ss 48/20 (58/20) -, Rn. 25, juris; Bayerisches Oberstes Landesgericht; Beschluss vom 20.08.2021 – 206 StRR 87/21 -, Rn. 17). Dies wird allein schon im Hinblick auf den ungewollten Kontakt mit dem Sperma des Sexualpartners sowie dem damit verbundenen erhöhten Risiko einer ungewollten Schwangerschaft deutlich, auch wenn dies nicht die Motive des Opfers für die ablehnende Haltung sein müssen (Bayerisches Oberstes Landesgericht; Beschluss vom 20.08.2021 – 206 StRR 87/21 -, Rn. 17; juris; KG Berlin, Beschluss vom 27.07,2020 – (4) 161 Ss 48/20 (58/20) -, Rn. 25, juris). Ebenso wie nach der vorzitierten obergerichtlichen Rechtsprechung die Verwendung eines Kondoms konstitutiver Bestandteil für das Einverständnis mit der sexuellen Aktivität sein kann, kann dies genauso auch die Bedingung des Opfers sein, den vaginalen Geschlechtsverkehr vor dem Samenerguss zu beenden. Dass diese Art der Empfängnisverhütung im Vergleich zu anderen Verhütungsmethoden deutlich unsicherer ist, ändert nichts an der Beachtlichkeit des Opferwillens. Setzt sich der Sexualpartner bewusst absprachewidrig über diese vom Opfer gesetzte Grenze hinweg, stellt dies eine so erhebliche Abweichung vom konsentierten sexuellen Handlungsgeschehen dar, dass die sexuelle Handlung nicht mehr vom tatbestandsausschließenden Einverständnis gedeckt und damit regelmäßig nach § 177 Abs. 1 StGB strafbar ist.
dd) Gemessen an den vorbeschriebenen Anforderungen hat der Angeklagte nach den tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils in objektiver Hinsicht sexuelle Handlungen an der Nebenklägerin gegen deren erkennbaren Willen vorgenommen.
So war zwischen ihm und der Nebenklägerin verbindlich abgesprochen, dass er den Geschlechtsverkehr nur dann bis zum Samenerguss vollzieht, wenn ein Verhütungsmittel – konkret Kondom oder Vaginalring – zum Einsatz kommt. Anderenfalls sollte der Vaginalverkehr vor dem Samenerguss beendet und hierdurch das Risiko einer Schwangerschaft gesenkt werden.
Dass vorliegend die von der Nebenklägerin aufgestellte Bedingung für den vaginalen Geschlechtsverkehr bis zum Samenerguss in objektiver und subjektiver Hinsicht nicht vorlag, ist durch das Landgericht nicht ausdrücklich festgestellt worden. In objektiver Hinsicht ergibt sich dies jedoch hinreichend deutlich aus den Gesamtumständen. Denn nur so ist plausibel, dass die Nebenklägerin über den Vollzug des Geschlechtsverkehrs bis zum Samenerguss in Wut geriet und in den Kleidungsstücken des Angeklagten Geld für die „Pille danach“ suchte. Zugleich folgt hieraus, dass die Nebenklägerin ihre Ablehnung gegen den Vollzug des Geschlechtsverkehrs bis zum Samenerguss auch nicht zwischenzeitlich – was angesichts des dynamischen Verlaufs des sexuellen Geschehens stets als Möglichkeit in Betracht zu ziehen ist – aufgegeben hatte.
b) In subjektiver Hinsicht fehlt es hingegen – worauf die Generalstaatsanwaltschaft zutreffend hingewiesen hat – an den erforderlichen Feststellungen. Weder lässt sich dem Urteil entnehmen, ob der Angeklagte vorsätzlich in Bezug auf den fehlenden Bedingungseintritt, insbesondere also in Bezug auf die fehlende Verwendung eines Vaginalrings durch die Nebenklägerin handelte, noch ob er den vorzeitigen Abbruch des Geschlechtsverkehrs vorsätzlich unterließ.
Dem Senat ist bewusst, dass es das Tatgericht voraussichtlich vor erhebliche Probleme stellen wird, die in subjektiver Hinsicht bestehenden Feststellungslücken zu schließen. Die zu erwartenden Beweisschwierigkeiten sind jedoch gerade typische Folge des Regelungsmodells des § 177 Abs. 1 StGB (Renzikowski, in: MünchKomm, a.a.O., § 177 StGB Rn. 53) und haben im Falle der Unerweislichkeit den Freispruch des Angeklagten zur Folge.“