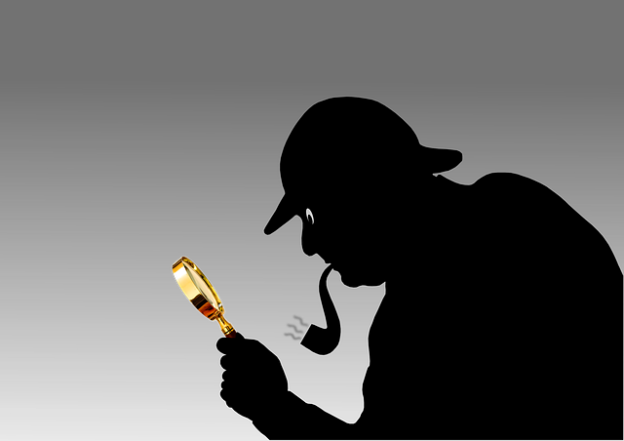Und dann geht es weiter mit StPO. Ich beginne mit einer Entscheidung des OLG Hamm zum Auskunftsverweigerungsrecht eines Zeugen nach § 55 StPO.
Hier hatte der betroffene Zeuge in der Hauptverhandlung gegen den Angeklagten nach erfolgter Belehrung erklärt hatte, er werde kein Zeugnis ablegen. Daraufhin hat die Strafkammer dem Zeugen die durch seine Verweigerung verursachten Kosten auferlegt, ein Ordnungsgeld in Höhe von 750 Euro (ersatzweise Ordnungshaft) verhängt sowie eine Beugehaft bis zum 29.05.2024 angeordnet. Dagegen die Beschwerde des Zeugen. Er meint, ihm stehe wegen der gemeinsamen Bandenzugehörigkeit von Angeklagtem und Zeugen ein umfassendes Recht zur Auskunftsverweigerung zu. Die Beschwerde hatte beim OLG mit dem OLG Hamm, Beschl. v. 04.06.2024 – 5 Ws 163/24 – Erfolg:
„Der angefochtene Beschluss war auf die Beschwerde aufzuheben, da dem Zeugen ein umfassendes Recht zur Aussageverweigerung zusteht; im Einzelnen:
1. Grundsätzlich ist ein Ordnungsgeldbeschluss bereits dann rechtsfehlerhaft, wenn dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör nicht in ausreichendem Maße gewährt worden ist. Das ist dann der Fall, wenn es an einer ausreichenden Belehrung fehlt (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 28.08.1995 – 3 Ws 486 – 487/95 = NStZ-RR 1996, 169, beck-online). Dieses ist hier der Fall, da die Strafkammer bei ihrer Belehrung den Umfang des Auskunftsverweigerungsrechts verkannt hat.
2. Zwar ist ein Zeuge grundsätzlich verpflichtet, vollständig zum Beweisthema auszusagen und kann nach § 55 Abs. 1 StPO nur die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 52 Abs. 1 StPO bezeichneten Angehörigen in die Gefahr bringen würde, wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden.
Allerdings sind in der höchstrichterlichen Rechtsprechung Fallkonstellationen anerkannt, in denen sich das Auskunftsverweigerungsrecht zum Aussageverweigerungsrecht verdichten kann (vgl. BGHSt 47, 220, 222). Dazu muss die Aussage aber mit etwaigem strafbaren Verhalten in so engem Zusammenhang stehen, dass eine Trennung nicht möglich ist (vgl. BGH NStZ 2002, 272, 273; StV 1987, 327, 328). Voraussetzung dafür ist insbesondere ein bereits nach Aktenlage nachvollziehbarer örtlicher und personeller Konnex zwischen der den Ermittlungsgegenstand bildenden Tat und der Person des die Auskunft verweigernden Zeugen (vgl. BVerfG NStZ 2002, 378; BGH NStZ 1999, 1413; BGHR StPO § 70, Weigerungsgrund 2). Gerade im Bereich der Rauschmitteldelikte kann der Kontakt zu einzelnen Beteiligten den Konnex bereits begründen (vgl. LG Hamburg, Beschluss vom 22. 6. 2007 – 618 Kls 2/07 = NStZ 2008, 588, beck-online). Besteht bei Rauschmitteldelikten die konkrete Gefahr, dass der Zeuge die Tatbeteiligten weiterer, noch verfolgbarer, eigener Delikte offenbaren, also Auskünfte über Teilstücke in einem mosaikartig zusammengesetzten Beweisgebäude geben und damit zugleich potenzielle Beweismittel gegen sich selbst liefern müsste, so ist ihm die Erteilung solcher Auskünfte nicht zumutbar (vgl. BVerfG, Beschluss vom 6.2.2002 – 2 BvR 1249/01 = NJW 2002, 1411, beck-online).
Ähnlich gelagert ist der Fall hier, da der Beschwerdeführer im Falle von Angaben zur Sache die Aufnahme von Ermittlungen betreffend etwaige, bislang nicht ermittelte Bandentaten befürchten muss.
3. Nach Aktenlage ergibt sich ein besonderer persönlicher Konnex zwischen dem Angeklagten und dem Beschwerdeführer. Ausweislich der (eröffneten) Anklageschrift vom 27.12.2023 waren sowohl der hiesige Angeklagte als auch der Beschwerdeführer Mitglieder derselben Bande, jedenfalls soweit es die Betäubungsmitteltransporte nach S. (B.) betrifft. Hinsichtlich der Gefahr einer Selbstbelastung des Zeugen ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die beim Beschwerdeführer abgeurteilten bzw. eingestellten Taten und die hiesigen angeklagten Taten lediglich einen kurzen Zeitraum vom 23.01.2022 bis zum 17.03.2022 betreffen, wohingegen die Betäubungsmittelaktivitäten der Bande ausweislich des wesentlichen Ergebnisses der Ermittlungen bereits ab dem Februar 2021 zutage treten, beispielsweise bei einer – nicht angeklagten – Transportfahrt nach S. am 20.10.2021. Für den Beschwerdeführer ergibt sich außerdem die Gefahr, dass er durch die Preisgabe der Bandenzusammensetzung, der Struktur oder des Modus Operandi Tatsachen für das Vorliegen eines Anfangsverdachts von weiteren Straftaten liefert. Letztlich dürfte es dem Beschwerdeführer unzumutbar sein, Auskünfte betreffend die Bandenzugehörigkeit des Angeklagten bzw. dessen Bestellungen von Betäubungsmitteln zu offenbaren, da dadurch – über das eigene Strafverfahren hinaus – das Risiko bestünde, dass der Angeklagte als Vergeltung ihm bekannt gewordene – bislang nicht ermittelte – weitere Betäubungsmittelgeschäfte der Gruppierung unter Mitwirkung des Beschwerdeführers aufdeckt (vgl. dazu BVerfG, Beschluss vom 6.2.2002 – 2 BvR 1249/01 = NJW 2002, 1411, beck-online).“
Und:
„4. Für die ausgesprochene Beugehaft bestand auch nach ihrem Vollzug ein fortwirkendes Rechtsschutzbedürfnis, da es sich bei dem angeordneten Freiheitsentzug um einen schwerwiegenden Grundrechtseingriff handelt und die Beugehaft – im Falle ihrer Rechtmäßigkeit – nicht nach § 51 Abs. 1 StGB auf die Strafvollstreckung angerecht werden kann (vgl. BVerfG (3. Kammer des Zweiten Senats), Beschluss vom 9.9.2005 – 2 BvR 431/02 = NJW 2006, 40, beck-online). Aufgrunddessen war die Rechtswidrigkeit der erledigten Maßnahme entsprechend § 115 Abs. 3 StVollzG auszusprechen.“