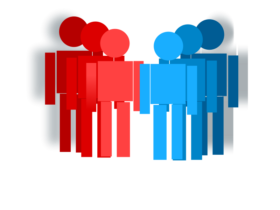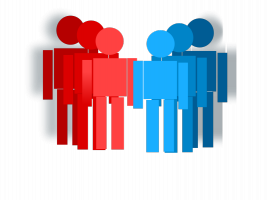Die zweite Entscheidung kommt vom OLG Köln. Das hat im OLG Köln, Beschl. v. 31.03.2020 -III 1 Rvs 58/20 über einen in meinen Augen „leicht atypischen“ Sachverhalt entschieden, und zwar.
Am 15.01.2020 hat vor dem AG Köln – Schöffengericht – die Hauptverhandlung gegen die drei Angeklagten stattgefunden; verfahrensgegenständlich sind Taten vom 13.10.2018, die die Staatsanwaltschaft gemäß Anklage vom 04.06.2019 als Raub und Freiheitsberaubung angeklagt hat. Das Hauptverhandlungsprotokoll vom 15.01.2020 weist folgenden Eintrag auf:
„Die Schöffen signalisieren nach Blickkontakt mit dem Richter ihre Zustimmung. Der Vorsitzende Richter erklärt sodann: Dann machen wir das so: Freispruch.“
Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Ausspruch ein Rechtsmittel eingelegt, das am 16.01.2020 beim AG eingegangen ist. Der Vorsitzende des Schöffengerichts ist ausweislich seines Aktenvermerks vom 03.02.2020 der Ansicht, es sei kein rechtswirksames Urteil ergangen; er beabsichtigt, einen neuen Hauptverhandlungstermin zu bestimmen. Diesen Aktenvermerk hat er der Staatsanwaltschaft „U.m.A. unter Hinweis auf obigen Vermerk zur Kenntnis und ggf. Stellungnahme“ übersandt. Wann die Akte bei der Staatsanwaltschaft eingegangen ist, ist nicht aktenkundig. Mit Verfügung vom 18.02.2020 hat die Staatsanwaltschaft um Absetzung des Urteils gebeten und Ausführungen dazu gemacht, dass nach ihrer Auffassung das Gericht ein (freisprechendes) Urteil verkündet habe. Mit Verfügung vom 05.03.2020 hat der Vorsitzende an seiner Rechtsauffassung festgehalten, bei der Staatsanwaltschaft „angefragt“ ob an dem Rechtsmittel festgehalten wird und um Spezifizierung als Berufung oder Revision gebeten. Ein schriftliches Urteil ist bislang nicht abgesetzt worden. Mit Verfügung vom 10.03.2020 hat die Staatsanwaltschaft das Rechtsmittel als Revision bezeichnet. Der Vorsitzende des Schöffengerichts hat die Akte im Hinblick darauf (unmittelbar) dem Senat vorgelegt.
Das OLG hat die Akten zurückgegeben und meint:
„Eine Entscheidung des Senats ist nicht veranlasst.
Zwar hat das Amtsgericht in der Hauptverhandlung vom 15. Januar 2020 ein rechtswirksames Urteil verkündet, gegen das die Staatsanwaltschaft fristgerecht „Rechtsmittel“ eingelegt hat. Da das Urteil aber bisher nicht wirksam zugestellt wurde, wurde auch die Revisionsbegründungsfrist, innerhalb derer eine Spezifizierung des Rechtsmittels erfolgen kann, nicht in Gang gesetzt. Die Akte ist daher an das Amtsgericht zurückzugeben, damit die Zustellung bewirkt werden kann.
1. Das freisprechende Erkenntnis des Amtsgerichts vom 15. Januar 2020 stellt ein rechtwirksames Urteil dar, gegen das ein Rechtsmittel statthaft ist.
Wesentlicher Teil der Urteilsverkündung ist die Verlesung der Urteilsformel; fehlt sie, so liegt kein Urteil im Rechtssinne vor (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 62. Auflage, § 268 Rn. 5 m.w.N.). Demnach enthält die Urteilsformel den eigentlichen Urteilsausspruch. § 173 Abs. 1 GVG bezeichnet sie sogar als das „Urteil“. Ist die Formel nicht verkündet, so liegt deshalb kein Urteil im Rechtssinne vor (vgl. BGHSt 8, 41 ff, zitiert nach juris, Rn. 8).
Ausweislich des Sitzungsprotokolls, welchem nach § 274 StPO formelle Beweiskraft zukommt, hat der Vorsitzende des Schöffengerichts in der Hauptverhandlung eine Urteilsformel verkündet. Zwar verstieß die Verfahrensweise des Tatrichters gegen die Verfahrensvorschrift des § 268 Abs. 2 S 1 StPO, weil – wie sich aus dem von ihm selbst niedergelegten Aktenvermerk vom 3. Februar 2020 ergibt – der Tenor nicht zuvor schriftlich niedergelegt und nicht durch Verlesung verkündet wurde. Eine verkündete Urteilsformel begründet jedoch auch dann ein rechtswirksames und damit rechtsmittelfähiges Urteil, wenn eine Urteilsformel verkündet wird, die zuvor nicht oder nicht vollständig schriftlich niedergelegt wurde (vgl. so wohl in der Tendenz auch Beck-OK-Peglau, § 268 Rn. 4: „fraglich“). Der Sinn und Zweck des Erfordernisses, die Urteilsformel zunächst zu verschriftlichen und sodann zu verlesen, besteht darin, die Übereinstimmung zwischen der verkündeten Urteilsformel und der protokollierten und in das schriftliche Urteil übergehenden Formulierung zu sichern (vgl. RGSt 16, 347, 349). Diese Sicherungs- und Beweiszwecke führen aber nach Auffassung des Senats nicht dazu, dieses in der Prozessordnung vorgesehene Erfordernis als konstitutiv für die Rechtswirksamkeit eines Urteils anzusehen. Denn das Gericht hat, indem es einen Tenor verkündet hat, eine Entscheidung über den Anklagegenstand treffen wollen und tatsächlich getroffen, eine solche Entscheidung ausgesprochen und schließlich protokolliert. Einen Grund, darin gleichwohl ein „Nichts“, mithin eine „nichtige“ richterliche Entscheidung zu sehen, ist nicht erkennbar. Gegen ein konstitutives Erfordernis in diesem Sinne spricht – im Sinne einer Kontrollüberlegung – im Übrigen auch, dass die Strafprozessordung keinerlei Regelungen enthält oder Vorgaben dazu macht, an welcher Stelle eine Verschriftlichung vor Verlesung zu erfolgen hat bzw. dass eine solche etwa zum Gegenstand der Akte gemacht werden müsste.
Auch wenn die von dem Vorsitzenden des Schöffengerichts verkündete Urteilsformel „Wir machen das jetzt so: Freispruch“ einen umgangssprachlichen und von üblichen Tenorformulierungen deutlich abweichenden Wortlaut hat, war für alle Verfahrensbeteiligten – die im Übrigen auch zuvor übereinstimmend „Freispruch“ beantragt hatten – der verkündete Ausspruch in seinem Sinngehalt eindeutig. Die Angeklagten sind damit in erster Instanz rechtswirksam freigesprochen worden.
2. Das hiergegen gerichtete „Rechtsmittel“ der Staatsanwaltschaft ist unter dem 16. Januar 2020 rechtzeitig eingelegt worden. Eine Behandlung als (Sprung)Revision und Entscheidung hierüber durch den Senat als Revisionsgericht kann aber derzeit nicht erfolgen, weil die Frist zur Begründung einer Revision mangels Zustellung des Urteils noch nicht in Gang gesetzt worden ist und damit auch nicht abgelaufen sein kann.
Solange sich der Beschwerdeführer nicht endgültig und verbindlich für die Wahl der Revision entscheidet, ist das von ihm eingelegte Rechtsmittel eine Berufung (BGHSt 33, 183, 189 = NJW 1985, 2960, 2961; SenE v. 15.10.1991 – Ss 481/91 – = NStZ 1992, 204, 205; OLG Köln 3. StrS MDR 1980, 690 = VRS 59, 436). Die endgültige Wahl zwischen Berufung und Revision muss bis zum Ablauf der Revisionsbegründungsfrist des § 345 Abs. 1 StPO getroffen werden (BGHSt 40, 398; Meyer-Goßner, a.a.O., § 335 Rn. 3). Dies setzt denknotwendig voraus, dass eine Revisionsbegründungsfrist überhaupt in Gang gesetzt wurde.
Die Frist zur Begründung der Revision, die auch maßgeblich ist für die Spezifizierung eines zunächst unbenannt eingelegten Rechtsmittels, ergibt sich aus § 345 Abs. 1 StPO. Danach beginnt die Monatsfrist regelmäßig mit der Zustellung des schriftlichen Urteils. Nach § 275 Abs. 1 StPO ist das schriftliche Urteil, sofern es nicht bereits vollständig in das Protokoll aufgenommen ist, unverzüglich zu den Akten zu bringen. Dies muss spätestens fünf Wochen nach der Verkündung geschehen. Nach Ablauf der Frist dürfen die Urteilgründe nicht mehr geändert werden. Dementsprechend genügt für den Fristbeginn die Zustellung der Urteilsformel, wenn Gründe nicht vorhanden sind oder wenn Gründe verloren gegangen sind, die nicht wiederhergestellt werden können (vgl. Meyer-Goßner, a.a.O., § 345 Rn. 5).
Der – ungewöhnliche und von der Prozessordnung nicht vorgesehene – Fall, dass es keine Urteilsgründe gibt (und nach Ablauf von fünf Wochen nach Verkündung auch nicht mehr geben kann), weil der Vorsitzende rechtsirrig die Auffassung vertritt, er habe gar kein Urteil gesprochen und daher davon absieht, schriftliche Urteilsgründe zur Akte zu bringen, ist nach Auffassung des Senats mit Blick auf den Beginn der Revisionsbegründungsfrist entsprechend zu behandeln, d.h. maßgeblich ist die Zustellung der Urteilsformel. Auch eine solche ist aber bisher nicht erfolgt. Zwar hat der Vorsitzende des Schöffengerichts unter dem 3. Februar 2020 die Übersendung der Hauptakte „zur Kenntnis- und Stellungnahme“ an die Staatsanwaltschaft verfügt, dies jedoch formlos und nicht unter Hinweis auf und nach Maßgabe des insoweit einschlägigen § 41 StPO. Darin vermag der Senat schon deswegen keine förmliche Zustellung zu erkennen, weil entgegen § 41 Abs. 1 S 2 StPO der „Tag der Vorlegung“ von der Staatsanwaltschaft nicht auf der Urschrift vermerkt wurde, so dass sich der Tag des Fristbeginns auch nicht feststellen lässt.
Ist die Revisionsbegründungfrist nicht in Gang gesetzt, konnte das Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft durch die nachfolgende Verfügung vom 10. März 2020 – deren Eingang bei Gericht sich ebenfalls nicht aus der Akte ergibt – auch nicht verbindlich und rechtswirksam zur Revision bestimmt werden. Damit wirkt es sich nicht aus, dass der Senat den Zuschriften der Staatsanwaltschaft bis heute keine zulässige Revisionsbegründung in Gestalt einer zulässig erhobenen Verfahrens- oder Sachrüge entnehmen kann.
3. Der Senat gibt die Sache daher an das Amtsgericht zur Bewirkung einer förmlichen Zustellung der Urteilsformel zurück.
Für die weitere Verfahrensweise regt der Senat an, den Übergang zur Sprungrevision zu überdenken. Würde das Rechtsmittel fristgerecht zur Revision bestimmt und würde die Staatsanwaltschaft – was bisher nicht erfolgt ist – die Revision nach Maßgabe des § 344 Abs. 2 StPO zulässig begründen, würde dies nach den Regelungen des § 349 StPO die Durchführung einer mit erheblichen Kosten verbundenen Revisionshauptverhandlung erforderlich machen, die nach derzeitigem Sachstand ohne Sachprüfung schon deshalb zur Urteilsaufhebung führen könnte, weil das Urteil keine schriftlichen Gründe hat. Auch um weitere zeitliche Verzögerungen zu vermeiden, erscheint es daher sachgerechter, das Rechtsmittel in der Tatsacheninstanz als Berufung durchzuführen.“