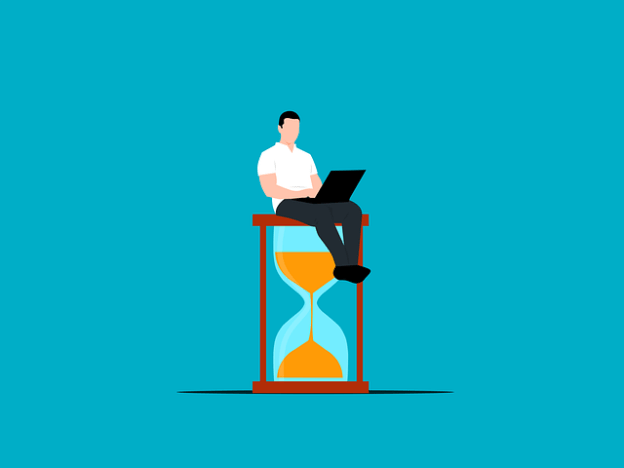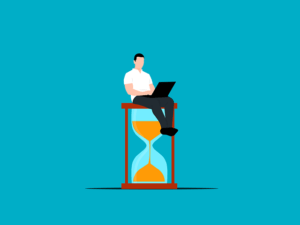Heute stelle ich dann mal wieder zwei Entscheidungen zum RVG bzw. zu Kostenfragen vor. I
Ich beginne mit dem BayLSG, Beschl. v. 15.09.2022 – L 12 SF 159/20. Ja, sozialgerichtliches Verfahren. Aber zumindest die Ausführungen des BayLSG zur Frage der Verwirkung einer Erinnerung haben auch über das Sozialgerichtsverfahren hinaus Bedeutung.
Gestritten wird zwischen den Beteiligten um die Höhe der aus der Staatskasse zu erstattenden Vergütung nach Beiordnung im Rahmen der Bewilligung von PKH sowie daüber, ob das Erinnerungsrecht der Beschwerdeführerin verwirkt ist. Nach Abschluss des Verfahrens hat die bestellte Rechtsanwältin mit Antrag vom 11.01.2019 ihren Vergütungsanspruch gegen die Staatskasse in Höhe von insgesamt 470,05 EUR geltend gemacht. Dabei wurden eine Verfahrensgebühr in Höhe von 375,00 Euro sowie die Postpauschale zuzüglich Umsatzsteuer angesetzt. Mit Beschluss vom 07.02.2019 setzte die zuständige Urkundsbeamtin abweichend vom Antrag die Vergütung auf insgesamt 380,80 EUR fest. Sie setzte dabei neben der wie beantragt festgesetzten Postpauschale die Verfahrensgebühr auf 300,00 Euro fest. Hiergegen wandte sich die Rechtsanwältin mit ihrer Erinnerung vom 09.01.2020. Die angesetzte Verfahrensgebühr in Höhe von 375,00 EUR entspreche billigem Ermessen. Der Erinnerungsgegner und Beschwerdegegner (Bg) hält die nach Ablauf von mehr als drei Monaten nach Erlass des Vergütungsfestsetzungsbeschlusses eingelegte Erinnerung für verwirkt.
Das SG hat die Erinnerung als zwar nicht verwirkt, aber als unbegründet zurückgewiesen. Dagegen dann die Beschwerde an das LSG. Die hatte Erfolg.
Zur Erinnerung führt das LSG u.a. aus:
„Unabhängig vom zeitlichen Moment bedarf die Annahme einer Verwirkung auch im Kostenrecht noch eines Umstandsmoments (vgl. Keller, in: jurisPR-SozR 8/2019, Anm. 3, E.; LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 10.12.2018 – L 7 AS 4/17 B, juris Rn. 17; Thüringer LSG, Beschluss vom 23.07.2018 – L 1 SF 497/16 B, juris Rn. 18 ff.; LSG NRW, Beschluss vom 30.04.2018 – L 9 AL 223/16 B, juris Rn. 35 f.). Soweit sich das BayLSG in der Vergangenheit darauf festgelegt hat, dass im Rahmen einer Gesamtbetrachtung eine Verwirkung zumindest der Staatskasse regelmäßig schon nach Ablauf eines Jahres nach Wirksamwerden der Gebührenfestsetzungsentscheidung eintritt (grundlegend Bayerisches LSG, Beschluss vom 04.10.2012 – L 15 SF 131/11 B E, juris Rn. 18 ff.), ohne zwischen Zeit- und Umstandsmoment zu unterscheiden, hält der Senat hieran nicht mehr fest (vgl. hierzu Grundsatzbeschluss des Senats vom 29.08.2022, L 12 SF 298/18). Denn allein der Zeitablauf begründet keine Verwirkung. Zwar kann das Erinnerungsrecht sowohl der Staatskasse als auch des Rechtsanwalts nicht „bis in alle Ewigkeit“ bestehen bleiben. Dies ergibt sich aus dem verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzprinzip, wonach Entscheidungen von Behörden und Gerichten innerhalb angemessener Zeit bestandskräftig bzw. rechtskräftig werden können und diejenigen Entscheidungen, die bestands- bzw. rechtskräftig geworden sind, grundsätzlich nicht mehr abgeändert werden; dabei hat letzt-endlich eine Abwägung gegen das Prinzip der materiellen Richtigkeit zu erfolgen (vgl. Bayerisches LSG, Beschluss vom 4. Oktober 2012 – L 15 SF 131/11 B E, nach juris). Dem wird durch das Rechtsinstitut von Treu und Glauben nach § 242 das Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in Gestalt des Rechtsinstituts der Verwirkung Rechnung getragen. Anhaltspunkte für eine absolute Obergrenze bereits nach einem Jahr sind nicht ersichtlich und können auch nicht mit entsprechenden Anfechtungsfristen bei falscher oder unrichtiger Rechtsbehelfsbelehrung begründet werden (Thüringer Landessozialgericht, Beschluss vom 26. September 2018 – L 1 SF 803/16 B –, juris). Demnach scheidet erst recht die Annahme des Vorliegens eines Zeitmoments nach nur drei Monaten, wie das SG unter Verweis auf die Rechtsprechung des OLG Koblenz annimmt, aus.
Zudem fehlt es hier an einem Umstandsmoment. Allein aufgrund der Tatsache, dass die Bfin nicht innerhalb eines Jahres Erinnerung eingelegt hatte, durfte sich der Bg nicht darauf einrichten, die Bfin werde ihr Recht auf Erinnerung nicht mehr geltend machen. Andere Umstände, aus denen dem Bg ein Vertrauensschutz hätte erwachsen können, liegen nicht vor, zumal die Bfin umfangreich begründet hat, warum sie ihr Erinnerungsrecht erst nach 11 Monaten ausgeübt hat.“
Und zu § 14 RVG heißt es dann:
„Bei der Bestimmung der billigen Gebühr anhand der Kriterien von § 14 Abs. 1 RVG wird dem Rechtsanwalt zu Recht und im Einklang mit der Systematik des § 315 BGB ein gewisser Spielraum bzw. Toleranzrahmen zugestanden. In Übereinstimmung mit der ober-gerichtlichen Rechtsprechung hält der Senat nach wie vor eine vom Rechtsanwalt bestimmte Gebühr für noch verbindlich, wenn sie bis zu 20% von der Gebühr abweicht, die der Kostenbeamte und ggf. das Gericht bzw. Beschwerdegericht für angemessen halten (vgl. auch Mayer, in: Gerold/Schmidt, RVG, 25. Aufl., § 14, Rdnr. 12, m.w.N.; Toussaint, Kostengesetze, 52. Aufl., § 14, Rdnr. 24; vgl. zur Berechnung der Toleranzgrenze Be-schluss des Senats vom 24.03.2020, L 12 SF 271/16 E). Auch unter Berücksichtigung des Toleranzrahmens war die Gebührenanforderung der Bfin unbillig. Bei Betrachtung der o.g. Kriterien des § 14 Abs. 1 Satz 1 und 3 RVG lag der Rechtsstreit im leicht überdurchschnittlichen Bereich anderer Streitigkeiten.
Der Umfang der anwaltlichen Tätigkeit war im Vergleich mit den übrigen sozialgerichtlichen Verfahren (vgl. Bayer. Landessozialgericht, Beschluss vom 19.08.2011, Az.: L 6 SF 872/11 B m.w.N., nach juris) leicht überdurchschnittlich. Der Senat geht davon aus, dass eine anwaltliche Tätigkeit jedenfalls dann durchschnittlich umfangreich ist, wenn Klage erhoben, Akteneinsicht genommen, die Klage begründet und zu den (z.B. medizinischen, sonstigen tatsächlichen oder auch rechtlichen) Ermittlungen des Gerichts Stellung genommen wird, einschließlich der eben genannten Tätigkeiten. Zu berücksichtigen ist dabei der zeitliche Aufwand, den der Rechtsanwalt tatsächlich in der Sache betrieb und objektiv verwenden musste (vgl. Bundessozialgericht BSG, Urteil vom 01.07 2009, Az.: B 4 AS 21/09 R, nach juris). Gleiches gilt auch für Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes. In diesen findet zwar nur eine summarische Prüfung durch das Gericht statt, allerdings hat der Antragsteller sowohl den Anordnungsgrund als auch den Anordnungsanspruch so darzulegen, dass das Gericht innerhalb kurzer Zeit zu einer Entscheidung in der Lage ist. Insbesondere die Darstellung des Anordnungsgrundes, also der Eilbedürftigkeit, kompensiert die aufgrund der kurzen Verfahrensdauer häufig eingeschränkte Anzahl an gewechselten Schriftsätzen. Die Tatsache, dass es sich um ein Eilverfahren handelt, darf sich demnach grundsätzlich nicht gebührenmindernd auswirken (vgl. hierzu auch Beschluss des Senates vom 15.11.2018, L 12 SF 124/14 sowie bereits BayLSG, Beschluss vom 05.10.2016, L 15 SF 282/15).
Hier fertigte die Bfin zur Begründung des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens eine Antragsschrift samt umfangreicher Antragsbegründung, die eine Sachverhaltsdarstellung sowie rechtliche Ausführungen zum Anordnungsanspruch sowie zum Anordnungsgrund enthielt. Es wurden zur Glaubhaftmachung umfangreiche Unterlagen beigefügt. Zudem musste die Bfin auf vier Schreiben des Antragsgegners replizieren und auch hierzu gezielt Unterlagen zur Untermauerung ihres Vorbringens anfügen. Akteneinsicht hat die Bfin nicht genommen, Gutachten oder medizinische Ermittlungen waren nicht erforderlich. Besprechungen sowie Schriftwechsel mit dem Mandanten wurden glaubhaft vorgetragen. Die Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit bewertet der Senat objektiv als durchschnittlich. Die Bedeutung der Angelegenheit für den Antragsteller bewertet der Senat angesichts der Sanktionen in Höhe von 100% als überdurchschnittlich, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Antragstellers als unterdurchschnittlich. Ein besonderes Haftungsrisiko der Bfin ist nicht ersichtlich.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass von einer leicht überdurchschnittlichen Angelegenheit auszugehen ist, die nach Auffassung des Senats unter Berücksichtigung der Toleranzgrenze von 20% den Ansatz einer Verfahrensgebühr von 375,00 Euro gerade noch rechtfertigt.“