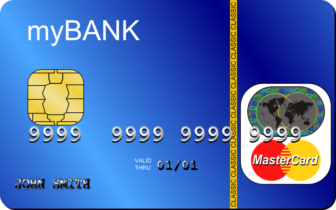Und als zweite „beA-Entscheidung“ dann hier noch der BGH, Beschl. v. 31.05.2023 – XII ZB 428/22. Der kommt aus dem Betreuungsrecht, und zwar mit folgendem Sachverhalt:
Für die 1960 geborene Betroffene ist eine Betreuung eingerichtet und der als Rechtsanwalt zugelassene Beteiligte zum Berufsbetreuer bestellt worden. Mit Schriftsatz vom 04.052022 hat der Betreuer beantragt, für seine Tätigkeit im Zeitraum vom 28.012022 bis zum 27.04.2022 eine Vergütung in Höhe von 513 EUR gegen die Staatskasse festzusetzen. Das AG hat den Vergütungsantrag nach vorangegangenem Hinweis als unzulässig zurückgewiesen, weil er nicht als elektronisches Dokument eingereicht worden sei. Dagegen hat sich der Betreuer mit seiner vom AG zugelassenen und in schriftlicher Form eingelegten Beschwerde gewendet, die das LG verworfen hat. Hiergegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde des Betreuers, die keinen Erfolg hatte:
„Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.
1. Das Beschwerdegericht ist von der Unzulässigkeit der Erstbeschwerde ausgegangen, weil die Beschwerdeschrift von einem Rechtsanwalt eingelegt, aber entgegen § 14 b Abs. 1 FamFG nicht als elektronisches Dokument übermittelt worden sei.
2. Dies hält rechtlicher Überprüfung stand.
Gemäß § 14 b Abs. 1 Satz 1 FamFG sind durch einen Rechtsanwalt, durch einen Notar, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts bei Gericht schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen als elektronisches Dokument zu übermitteln. Wird diese Form nicht eingehalten, ist die Erklärung unwirksam und wahrt die Rechtsmittelfrist nicht.
a) § 14 b FamFG wurde ursprünglich durch das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013 ( I S. 3786) in das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit eingefügt. Die Vorschrift orientierte sich in ihrer damaligen Fassung inhaltlich an dem gleichzeitig eingeführten und weitgehend wortgleichen § 130 d ZPO. Noch vor dem Inkrafttreten von § 14 b FamFG zum 1. Januar 2022 erfolgte durch das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607) zur Klarstellung eine inhaltliche Änderung der Vorschrift, wonach die Pflicht zur elektronischen Übermittlung ausdrücklich auf schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen beschränkt (§ 14 b Abs. 1 FamFG) wurde. Für sämtliche anderen Anträge und Erklärungen, die keinem Schriftformerfordernis unterliegen, ist die elektronische Einreichung nach § 14 b Abs. 2 FamFG nur eine Sollvorschrift. Damit sollte den Besonderheiten des Familienverfahrensrechts Rechnung getragen werden, in dem der Schriftformzwang die Ausnahme bildet (vgl. BT-Drucks. 19/28399 S. 39 f.).
b) Der sachliche Anwendungsbereich des § 14 b 1 Satz 1 FamFG ist bei der Einlegung einer Beschwerdeschrift durch einen Rechtsanwalt eröffnet.
Zwar sieht § 64 Abs. 2 Satz 1 FamFG vor, dass die Beschwerde – außer in Ehe- und Familienstreitsachen (§ 64 Abs. 2 Satz 2 FamFG) sowie in Folgesachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (vgl. Senatsbeschluss BGHZ 215, 1 = FamRZ 2017, 1151 Rn. 19) – nicht nur durch Einreichung einer Beschwerdeschrift, sondern auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eingelegt werden kann. Diese Möglichkeit soll einen erleichterten Zugang zu den Rechtsmittelgerichten gewähren, um damit insbesondere den Rechtsschutz für rechtsunkundige oder schreibungewandte Beteiligte zu wahren. § 64 Abs. 2 Satz 1 FamFG räumt daher dem Verfahrensbeteiligten ein Wahlrecht ein. Entscheidet er sich aber dafür, die Beschwerde schriftlich einzureichen, muss seine Beschwerdeschrift als bestimmender Schriftsatz besonderen gesetzlich vorgesehenen Formerfordernissen (§ 64 Abs. 2 Satz 3 und 4 FamFG) entsprechen. Zu diesen Formerfordernissen gehört für Rechtsanwälte seit dem 1. Januar 2022 auch § 14 b Abs. 1 Satz 1 FamFG. Daher ist ein Rechtsanwalt seit diesem Zeitpunkt zur Übermittlung der Beschwerdeschrift als elektronisches Dokument verpflichtet, wenn er die Beschwerde – wie hier – schriftlich und nicht zur Niederschrift der Geschäftsstelle einlegt (vgl. Senatsbeschlüsse vom 7. Dezember 2022 – XII ZB 200/22 – FamRZ 2023, 461 Rn. 7 f. und vom 21. September 2022 – XII ZB 264/22 – FamRZ 2022, 1957 Rn. 7; BGH Beschluss vom 31. Januar 2023 – XIII ZB 90/22 – FamRZ 2023, 719 Rn. 14). Hiervon ist ersichtlich auch der Gesetzgeber ausgegangen, denn in der Entwurfsbegründung des Gesetzes zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer prozessrechtlicher Vorschriften wird § 64 Abs. 2 FamFG ausdrücklich als Beispiel für eine Vorschrift genannt, die dem Anwendungsbereich des § 14 b Abs. 1 FamFG unterfallen soll (vgl. BT-Drucks. 19/28399 S. 39).
c) Auch der persönliche Anwendungsbereich des § 14 b 1 FamFG ist eröffnet. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist mittlerweile geklärt, dass für Rechtsanwälte die Pflicht zur elektronischen Übermittlung gemäß § 14 b Abs. 1 Satz 1 FamFG auch dann besteht, wenn sie – wie hier als anwaltlicher Berufsbetreuer – berufsmäßig im eigenen Namen auftreten (vgl. BGH Beschluss vom 31. Januar 2023 – XIII ZB 90/22 – FamRZ 2023, 719 Rn. 16 ff. [Verfahrenspfleger]; vgl. zu § 130 d ZPO: BGH Beschluss vom 24. November 2022 – IX ZB 11/22 – WM 2023, 89 Rn. 13 ff. [Insolvenzverwalter]).
aa) Dem Wortlaut des § 14 b 1 FamFG lässt sich für eine Beschränkung des persönlichen Anwendungsbereichs auf den Fall der Vertretung eines Beteiligten durch einen Rechtsanwalt nichts entnehmen.
Vielmehr deuten sowohl die auf eine „Nutzungspflicht für Rechtsanwälte“ abstellende amtliche Überschrift der Vorschrift als auch der Wortlaut von § 14 b Abs. 1 Satz 1 FamFG, wonach „durch einen Rechtsanwalt“ bei Gericht einzureichende Anträge und Erklärungen als elektronisches Dokument zu übermitteln sind, auf eine generelle Nutzungspflicht für Rechtsanwälte unabhängig von ihrer Rolle im Verfahren hin (vgl. BGH Beschluss vom 31. Januar 2023 – XIII ZB 90/22 – FamRZ 2023, 719 Rn. 17). Dies verdeutlicht auch ein Vergleich des Wortlauts der Parallelvorschrift des § 130 d Satz 1 ZPO mit dem Wortlaut des ebenfalls durch das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10. Oktober 2013 geschaffenen § 130 a Abs. 1 ZPO: Während nämlich in § 130 a Abs. 1 ZPO von Schriftsätzen der Parteien die Rede ist und damit womöglich ein Vertretungsverhältnis beim Handeln eines Rechtsanwalts gegenüber dem Gericht vorausgesetzt wird, wird in § 130 d Satz 1 ZPO – wie auch in § 14 b Abs. 1 Satz 1 FamFG – statusbezogen allein darauf abgestellt, dass Schriftsätze, Anträge und Erklärungen „durch einen Rechtsanwalt“ bei Gericht eingereicht werden (vgl. BGH Beschluss vom 24. November 2022 – IX ZB 11/22 – WM 2023, 89 Rn. 14).
bb) Der Gesetzesbegründung zu § 130 d ZPO, auf die hinsichtlich der Nutzungspflicht in den Materialien zu § 14 b FamFG inhaltlich verwiesen wird (BT-Drucks. 17/12634 S. 36), lässt sich für die Beurteilung der Frage nach einer rollen- oder statusbezogenen Nutzungspflicht des Rechtsanwalts nichts entnehmen. Einerseits spricht die Begründung zu § 130 d ZPO zwar davon, dass die Bestimmung „für alle anwaltlichen schriftlichen Anträge und Erklärungen nach der ZPO“ gelte, andererseits in Übereinstimmung mit dem Wortlaut der Vorschrift aber auch davon, dass für alle Rechtsanwälte eine Pflicht zur Nutzung des elektronischen Übermittlungswegs bestehe (BT-Drucks. 17/12634 S. 27). Es ist nicht auszuschließen, dass die Ausführungen an dieser Stelle im Regierungsentwurf von sprachlichen Ungenauigkeiten beeinflusst sind, denen eine besondere Bedeutung nicht beigemessen werden kann (vgl. BGH Beschlüsse vom 31. Januar 2023 – XIII ZB 90/22 – FamRZ 2023, 719 Rn. 19 und vom 24. November 2022 – IX ZB 11/22 – WM 2023, 89 Rn. 16).
cc) Entscheidend für ein weites und damit statusbezogenes Verständnis der Nutzungspflicht nach § 14 b 1 FamFG ist der Zweck der Norm, der ausweislich der Begründung (vgl. BT-Drucks. 17/12634 S. 27) darin besteht, durch eine Verpflichtung für alle Rechtsanwälte und Behörden zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten den elektronischen Rechtsverkehr einzuführen. Die Rechtfertigung eines Nutzungszwangs ergibt sich für den Gesetzgeber daraus, dass selbst bei freiwilliger Mitwirkung einer Mehrheit von Rechtsanwälten an diesem Ziel die Nichtnutzung durch eine Minderheit immer noch zu erheblichem Aufwand insbesondere bei den Gerichten führen würde. Es sei nicht hinzunehmen, erhebliche Investitionen der Justiz auszulösen, wenn die für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderliche Nutzung nicht sichergestellt sei. Dieser Gesetzeszweck lässt es nur konsequent erscheinen, anwaltliche Verfahrensbeteiligte, die ohnehin ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach für die elektronische Kommunikation vorzuhalten haben (§ 31 a BRAO), in die Nutzungspflicht einzubeziehen, auch wenn sie in dem Verfahren nicht im anwaltlichen Erstberuf tätig sind (vgl. BGH Beschlüsse vom 31. Januar 2023 – XIII ZB 90/22 – FamRZ 2023, 719 Rn. 20 und vom 24. November 2022 – IX ZB 11/22 – WM 2023, 89 Rn. 19).
dd) Der Anwendbarkeit von § 14 b FamFG auf den anwaltlichen Berufsbetreuer steht auch nicht entgegen, dass dieser dadurch anders als der nichtanwaltliche Berufsbetreuer behandelt wird, der weiterhin alle Anträge und Erklärungen gegenüber dem Gericht schriftlich vornehmen kann, solange er nicht seinerseits einen Rechtsanwalt mit seiner Vertretung betraut. Die sachliche Rechtfertigung für diese unterschiedliche Behandlung liegt darin, dass der anwaltliche Betreuer ohnehin über ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach verfügen muss und auch jenseits des Betreuungsverfahrens einem Zwang zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten unterliegt (vgl. BGH Beschlüsse vom 31. Januar 2023 – XIII ZB 90/22 – FamRZ 2023, 719 Rn. 20 und vom 24. November 2022 – IX ZB 11/22 – WM 2023, 89 19). Im Übrigen lässt die jüngere Gesetzgebung deutlich das Bestreben des Gesetzgebers erkennen, den elektronischen Rechtsverkehr mit der Justiz auch auf nichtanwaltliche Berufsbetreuer und Betreuungsvereine auszuweiten. Mit der Einführung des besonderen elektronischen Bürger- und Organisationenpostfachs (§ 10 ERVV) durch das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 5. Oktober 2021 sollen auch sonstige Beteiligte an Gerichtsverfahren künftig die Möglichkeit erhalten, mit dem Gericht elektronisch zu kommunizieren; beispielhaft werden in der Gesetzesbegründung Betreuerinnen und Betreuer genannt (vgl. BT-Drucks. 19/28399 S. 23).
ee) Vor diesem Hintergrund spricht es ebenfalls nicht gegen eine Nutzungspflicht des elektronischen Rechtsverkehrs durch einen anwaltlichen Betreuer, dass er diese Tätigkeit als Zweitberuf ausübt und seine Tätigkeit – abgesehen von anwaltsspezifischen Diensten für den Betreuten – nicht nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vergütet wird. Ebenso wenig kann es darauf ankommen, dass die Höhe der nach Fallpauschalen bestimmten Betreuervergütung (§§ 7 VBVG) nicht an die Zulassung als Rechtsanwalt, sondern an die abgeschlossene juristische Hochschulausbildung des Anwaltsbetreuers anknüpft.
Im Hinblick auf die für Rechtsanwälte ohnehin bestehende Vorhaltungs- und Nutzungspflicht der elektronischen Kommunikationsmittel spricht auch nichts für die Annahme, dass der Justizgewährungsanspruch verletzt werden könnte, wenn der Rechtsanwalt diese Kommunikationsmittel bei seiner beruflichen Tätigkeit als Betreuer zu nutzen hat. Ob im Einzelfall anders zu entscheiden wäre, wenn der als Rechtsanwalt zugelassene Betreuer seine Tätigkeit bewusst als Privatperson in eigener Sache entfaltet oder sein (ehrenamtliches) Betreueramt – nach außen erkennbar – von seiner Stellung als Rechtsanwalt trennt (vgl. Prütting/Helms/Ahn-Roth FamFG 6. Aufl. § 14 b Rn. 5; Sternal/Sternal FamFG 21. Aufl. § 14 b Rn. 8; Fritzsche NZFam 2022, 1, 3), bedarf unter den hier obwaltenden Umständen keiner Entscheidung, weil der Betreuer bei der Führung des Amtes als Berufsbetreuer auftritt.
III.
Die Entscheidung des Beschwerdegerichts, die schriftlich eingelegte Beschwerde des Betreuers zu verwerfen, hat daher Bestand.
Nur ergänzend weist der Senat darauf hin, dass der Vergütungsantrag des anwaltlichen Betreuers nicht als elektronisches Dokument eingereicht werden muss (insoweit zutreffend LG Hildesheim NJW-RR 2022, 1518, 1519). Der Vergütungsantrag des Betreuers nach § 292 Abs. 1 FamFG unterliegt, auch wenn mit ihm das Vergütungsfestsetzungsverfahren eingeleitet wird, vorbehaltlich (bislang nicht bestehender) abweichender landesrechtlichen Bestimmungen über die Verpflichtung zur Benutzung von Vordrucken (§ 292 Abs. 6 FamFG) keinem zwingenden Schriftformerfordernis. Nach § 25 Abs. 1 FamFG können Anträge und Erklärungen gegenüber dem zuständigen Gericht schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgegeben werden, soweit eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt nicht notwendig ist. Werden verfahrenseinleitende Anträge nicht zur Niederschrift der Geschäftsstelle, sondern schriftlich abgegeben, hängt deren Wirksamkeit – anders als nach § 64 Abs. 2 Satz 3 und 4 FamFG bei bestimmenden Schriftsätzen im Beschwerdeverfahren – nicht von der Beachtung zwingender Formvorschriften ab (vgl. § 23 FamFG), zu denen § 14 b Abs. 1 FamFG für Rechtsanwälte hinzutreten könnte. Auch die Gesetzesmaterialien gehen davon aus, dass für den Großteil von Anträgen und Erklärungen in Verfahren nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit kein Schriftformerfordernis besteht und diese deshalb dem § 14 b Abs. 2 FamFG unterfallen (BT-Drucks. 19/28399 S. 40). Der Betreuer darf seinen Vergütungsantrag deshalb auch dann in gewöhnlicher Schriftform stellen, wenn er als Rechtsanwalt zugelassen ist. Er ist in diesem Fall allerdings verpflichtet, auf Anforderung des Gerichts ein elektronisches Dokument nachzureichen (§ 14 b Abs. 2 Satz 2 FamFG).