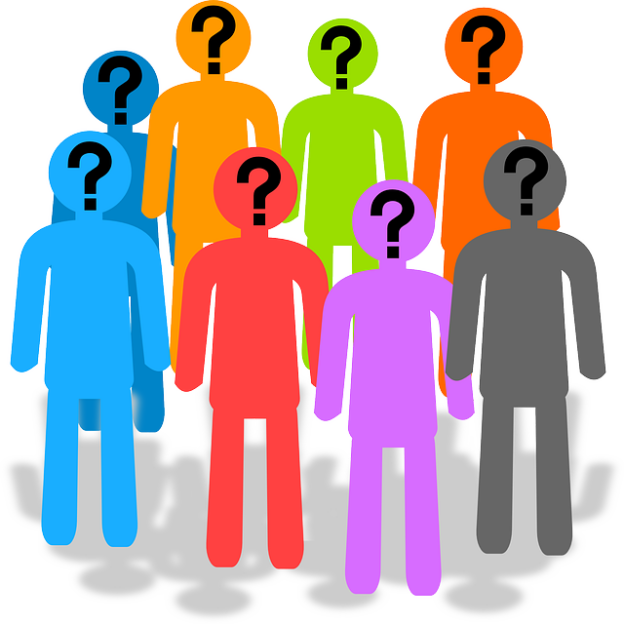Und am zweiten Tag der ersten „normalen“ Woche 2025 geht es dann gleich mit schweree (?) Kost weiter, nämlich dreimal etwas zur Volksverhetzung.
Ich beginne mit dem OLG Nürnberg, Beschl. v. 28.11.2024 – Ws 1076/24. Über den Beschluss ist ja auch schon anderweitig berichtet worden. Das ist die Entscheidung, in der das OLG zu dem Schlagwort „Alte weiße Männer stinken“ und zur der Frage Stellung genommen hat, ob sich mit dessen Verwendung der Anfangsverdacht einer Volksverhetzung begünden lässt.
Zugrunde liegt dem Verfahren die Strafanzeige eines Rechtsanwaltes – laut Briefkopf „Bundesrichter a.D.“. Der hat einer unbekannten Frau zur Last gelegt, bei einer Veranstaltung des „Feministischen Funparks“ der Verdi-Frauen am 08.03.2024 auf dem Kornmarkt in Nürnberg auf eine Pappwand, die mit zahlreichen Sprüchen und Parolen versehen war und dem Zweck diente, dass Frauen ihre Unzufriedenheit schriftlich äußern konnten, den Spruch „Alte, weiße Männer stinken“ geschrieben zu haben, worüber der Bayerische Rundfunk in der Frankenschau am 08.03.2024 berichtete. Der Anzeigeerstatter sieht hierin eine Volksverhetzung nach § 130 Abs. 1 Nr. 2 StGB zu seinem Nachteil, da es sich bei ihm um einen 67 Jahre alten, weißen Mann handele. Er fordert die Ermittlung der Identität der unbekannten Frau und deren strafrechtliche Verfolgung durch Vernehmung einer bei der Veranstaltung anwesenden, namentlich bekannten Zeugin.
Das OLG sagt mit der Generalstaatsanwaltschaft im Klageerzwingungsverfahren:
„b) Es besteht kein Anfangsverdacht dafür, dass sich die angezeigte Frau der Volksverhetzung nach § 130 StGB schuldig gemacht hat. Die angezeigte Handlung ist schon nicht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören, so dass es auf das Vorliegen der weiteren Tatbestandsmerkmale des § 130 Abs. 1 StGB nicht ankommt.
aa) Der öffentliche Friede umfasst den Zustand allgemeiner Rechtssicherheit und des befriedeten Zusammenlebens der Bürger sowie das Bewusstsein der Bevölkerung, in Ruhe und Frieden zu leben.
Bei § 130 StGB ist darüber hinaus zu beachten, dass zu dem öffentlichen Frieden auch ein Mindestmaß an Toleranz und ein öffentliches Klima gehört, das nicht durch Unruhe, Unfrieden oder Unsicherheit gekennzeichnet ist. Daher fällt die Gewährleistung von Friedlichkeit unter den öffentlichen Frieden, nicht aber der Schutz vor subjektiver Beunruhigung der Bürger durch die Konfrontation mit provokanten Meinungen und Ideologien. Der öffentliche Friede in diesem umfassenden Sinne kann zum einen durch eine infolge des Hervorrufens offener oder latenter Gewaltpotentiale entstandene Erschütterung des Vertrauens in die allgemeine Rechtssicherheit, vor allem auch durch die Verminderung des Sicherheitsgefühls des angegriffenen Teils der Bevölkerung, und zum anderen durch ein Aufhetzen des Publikums und der dadurch begründeten Gefahr weiterer Übergriffe beeinträchtigt werden. Eine Störung des öffentlichen Friedens kann insbesondere bereits durch die Vergiftung des öffentlichen Klimas eintreten, wenn etwa bestimmte Bevölkerungsteile ausgegrenzt und entsprechend behandelt werden, indem ihren Angehörigen pauschal der sittliche, personale oder soziale Geltungswert abgesprochen wird und sie unter Umständen durch den Angriff auf ihre Menschenwürde als „Unperson“ diffamiert werden.
Der öffentliche Friede muss durch die Tat einerseits nicht wirklich gestört oder auch nur konkret gefährdet werden. Erforderlich ist aber eine konkrete Eignung zur Friedensstörung; diese darf nicht nur abstrakt bestehen. Die Tat ist geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören, wenn sie nach Art und Inhalt der tatbestandserheblichen Äußerung sowie den sonstigen relevanten konkreten Umständen des Falles derart beschaffen ist, dass bei einer Gesamtwürdigung die Besorgnis gerechtfertigt ist, es werde zu einer Friedensstörung kommen. Aus der Sicht eines objektiven Beobachters muss auf Grund konkreter Umstände eine begründete Befürchtung vorliegen, der Angriff werde das Vertrauen in die öffentliche Rechtssicherheit erschüttern, sei es auch nur bei der Bevölkerungsgruppe, gegen die er sich richtet (MüKoStGB/Schäfer/Anstötz, 4. Auflage 2021, StGB § 130 Rn. 22f, beck-online).
bb) Die Prüfung, ob eine Handlung geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, ist anhand verschiedener Kriterien vorzunehmen, wobei in erster Linie auf den Inhalt sowie die Intensität des Angriffs abzustellen ist (MüKoStGB/Schäfer/Anstötz, 4. Aufl. 2021, StGB § 130 Rn. 24, beck-online). Dabei ist die Staatsanwaltschaft zu dem zutreffenden Ergebnis gekommen, dass dies nicht der Fall ist. Das Schlagwort „Alte weiße Männer stinken“, das im Rahmen einer feministischen Veranstaltung gebraucht wurde, ist nicht im direkten Wortsinn, sondern im übertragenen Sinn als Beitrag zu einer breit geführten gesellschaftlichen Diskussion zu verstehen, ohne dass damit der öffentliche Frieden gestört werden könnte.
(1.) Der Begriff „alte weiße Männer“ findet in Deutschland seit 2012 Verwendung und man versteht darunter weiße Männer, die in einer Zeit aufgewachsen sind, in der sie aufgrund ihres Weiß- und Männlich-Seins gesellschaftliche Privilegien genossen haben, die diese Privilegien und die Diskriminierung von z. B. Frauen und People of Color aber verleugnen und somit die Gleichberechtigung aller Menschen behindern (https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_weiße_Männer, abgerufen am 27.11.2024). Der Begriff ist auch Gegenstand verschiedener Abhandlungen in Wissenschaft und Literatur. So äußert die Soziologin Prof. Dr. Paula-Irene Villa Braslavsky, Inhaberin des Lehrstuhls für Soziologie /Gender-Studies an der Ludwig-Maximilian-Universität München, dass „Alter weißer Mann“ kein wissenschaftlicher Begriff sei, es sich vielmehr um ein Etikett oder Label handele, das im Moment viel genutzt werde, um in verkürzter und stereotyper Art und Weise ein bestimmtes Mindset, eine bestimmte Mentalität auf den Punkt zu bringen. Hinter der Figur des alten weißen Mannes stehe die Auseinandersetzung mit einer strukturellen und sehr tiefgehenden Geschichte von Gewalt, von Ausgrenzung, von Diskriminierung (https://www.deutschlandfunkkultur.de/alter-weisser-mann-patriarchat-woke-102.html, abgerufen am 27.11.2024). Dieses Verständnis des Begriffs hat auch in der breiten Bevölkerung Einzug gehalten. So ist unlängst der Film „Alter weißer Mann“ in den deutschen Kinos erschienen, der sich als Komödie mit dieser Thematik auseinandersetzt.
(2.) Es liegt somit auf der Hand, dass mit der Verwendung des Schlagworts „Alte weiße Männer stinken“ kurz und bündig ein Diskussionsbeitrag zur dargestellten Thematik geleistet werden sollte, ohne dass damit ernsthaft die Gruppe der „alten weißen Männer“ ausgegrenzt oder als im echten Wortsinn als „stinkend“ bezeichnet werden soll. Die Parole richtet sich nicht gegen den Bevölkerungsteil der betagten Männer weißer Hautfarbe.
Mit dem Schlagwort werden auch keine konkreten Maßnahmen gegen „alte weiße Männer“ verbunden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in ihrem Bescheid vom 22.10.2024 zutreffend ausführt, ist auch nicht erkennbar, dass es sich bei den „alten weißen Männern“ um eine besonders vulnerable Gruppe handelt, die in der Gesellschaft eine besonders gefährdete Position innehat oder die Opfer offener oder latenter Übergriffe ist.Im Ergebnis handelt es sich somit bei dem bei einer feministischen Veranstaltung neben weiteren Beiträgen geschriebenen Schlagwort „Alte weiße Männer stinken“ um einen zugespitzten Beitrag zu dem derzeit geführten gesellschaftlichen Diskurs aus Sicht der unbekannten Teilnehmerin, an dem sich letztlich auch der Anzeigeerstatter mit seiner Strafanzeige beteiligt hat. Eine Störung des öffentlichen Friedens ist dadurch aber nicht zu befürchten.“
Wenn ich solche Verfahren sehe, bin ich froh, dass ich damit nichts (mehr) zu tun habe. 🙂