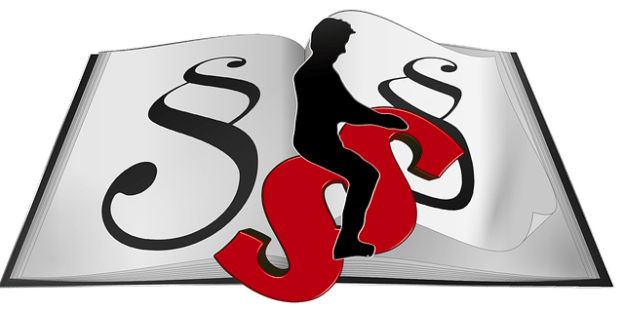Bei der zweiten Entscheidung, die ich vorstelle, handelt es sich um das OLG Dresden, Urt. v. 06.04.2023 – 8 U 1883/22.
Die Parteien streiten in dem Verfahren um die Zahlung von „Vermittlungsprovisionen“. Die Klägerin betreibt eine Website und bietet über die von ihr entwickelte Software Dienstleistungen für Betroffene an, die einen Anhörungsbogen bzw. Bußgeldbescheid zu einem behaupteten Verstoß gegen Vorschriften bei der Teilnahme am Straßenverkehr (Geschwindigkeits-, Abstands-, Wechsellicht-, Mobiltelefon-, Überhol- oder Vorfahrtsverstoß) erhalten haben. Zur Überprüfung der erhobenen Vorwürfe gegenüber den Betroffenen und der sich aus dem Prüfungsergebnis ergebenden Handlungsmöglichkeiten arbeitet die Klägerin mit Partnerkanzleien/Rechtsanwälten zusammen, zu denen auch die Beklagte gehört. Die Beklagte war seit 01.07.2018 eine der Partnerkanzleien und bezahlte bis zum 30.12.2020 die Rechnungen der Klägerin für ca. 40.000 Bußgeldfälle. Das waren 108 Rechnungen mit einem Gesamtbetrag ca. 3.900.000,00 EUR.
Gestritten wird jetzt um die Zahlung weiteren Entgelts von insgesamt 235.056,98 EUR für den Zeitraum vom 01.12.2020 bis 30.06.2021. Das LG hat die Klage abgewiesen. Die Klägerin habe gegen die Beklagte keinen vertraglichen Anspruch auf die Zahlung einer Lizenzgebühr, weil die zwischen den Parteien begründete Geschäftsbeziehung gemäß § 134 BGB nichtig sei, da sie gegen § 49b Abs. 3 Satz 1 BRAO verstoße. Ein Anspruch der Klägerin folge auch nicht aus Bereicherungsrecht. Das Erlangte sei nicht schlüssig dargetan. Ein Herausgabeanspruch der Klägerin an Teilen der Gebührenansprüche der Beklagten gegen ihre Mandanten bestehe nicht.
Dagegen die Berufung, die beim OLG Dresden keinen Erfolg hatte. Wegen der Einzelheiten der Begründung verweise ich auf das umfangreich begründete Urteil des OLG, aus dem ich hier nur folgende Passage einstelle:
„b) Die Vereinbarung der Parteien verstößt aber gegen ein gesetzliches Verbot und ist deshalb nach § 134 BGB nichtig. § 49b 3 Satz 1 BRAO bestimmt, dass die Abgabe und Entgegennahme eines Teils der Gebühren oder sonstiger Vorteile für die Vermittlung von Aufträgen, gleichviel ob im Verhältnis zu einem Rechtsanwalt oder Dritten gleich welcher Art, unzulässig ist. Kern des Rechtsstreits ist die – hier zu bejahende – Frage, ob die Klägerin von der Beklagten mit der Lizenzgebühr eine Vergütung für die Vermittlung von Mandanten erhalten sollte. Mit dem Provisionsverbot soll vermieden werden, dass Rechtsanwälte in einen Wettbewerb um den Ankauf von Mandaten treten; die Anwaltschaft ist kein Gewerbe, in dem Mandate „gekauft“ und „verkauft“ werden (BT-Drs. 12/4993, 31; BGH, Urteil vom 20.06.2016 – AnwZ (Brfg) 26/14, NJW 2016, 3105 Rn. 18, beck-online; Kilian in Henssler/Prütting, BRAO, 5. Auflage 2019, § 49b, Rn. 159; Peitscher in Hartung/Scharmer, BRAO, 8. Auflage 2022, § 49b, Rn. 76).
Eine Vermittlung setzt voraus, dass neben den Parteien des Anwaltsvertrages ein Dritter, d.h. eine kanzleifremde Person, an dessen Akquisition durch den Rechtsanwalt beteiligt ist (Kilian in Henssler/Prütting, BRAO, 5. Auflage 2019, § 49b, Rn. 164). Verboten ist jegliche Art und Form akquisebedingter Belohnung (Peitscher in Hartung/Scharmer, BRAO, 8. Auflage 2022, § 49b, Rn. 80). Pauschale Entgelte für die Bereitstellung von Infrastruktur, die es potentiellen Auftraggebern ermöglicht, ihn zu mandatieren (Anwaltssuchdienste, Telefonmehrwertdienste) fallen nicht unter das Verbot, wenn die Vergütung nicht von der Zahl der Mandatserteilungen abhängt (Kilian in Henssler/Prütting, BRAO, 5. Auflage 2019, § 49b, Rn. 165). Die erforderliche kausale Verknüpfung (Gebühr oder sonstiger Vorteil „für die Vermittlung von Aufträgen“) ist erfüllt, wenn sich die Gewährung oder die Entgegennahme des Vorteils und der beabsichtigte Abschluss eines Anwaltsvertrags wechselseitig bedingen (Kilian in Henssler/Prütting, BRAO, 5. Auflage 2019, § 49b, Rn. 159; Peitscher in Hartung/Scharmer, BRAO, 8. Auflage 2022, § 49b, Rn. 84). Vom Verbot nicht umfasst ist ein erfolgsunabhängiges, ohne Rücksicht auf die tatsächliche Auftragsvergabe geschuldetes Entgelt für Dienstleistungen, die nur eine Rahmenbedingung für die Erbringung anwaltlicher Tätigkeit schafft (Peitscher in Hartung/Scharmer, BRAO, 8. Auflage 2022, § 49b, Rn. 84).
(1) Die Zulässigkeit von mandats- und damit erfolgsunabhängigen Dienstleistungen ist in der Rechtsprechung anerkannt. Beispielsweise verstößt die Beteiligung an einer Anwalts-Hotline nicht gegen § 49b Abs. 3 BRAO, weil die fragliche Vergütung unabhängig davon geschuldet ist, ob und wie viele Ratsuchende in der fraglichen Zeit anrufen. Die erfolgsunabhängige Vergütung ist daher mit der Raummiete, mit den Kosten der Telefonanlage oder mit den Kosten für einen Anwaltssuchdienst im Internet vergleichbar (BGH, Urteil vom 26.09.2002 – I ZR 44/00, NJW 2003, 819, beck-online). Auch eine Versteigerung von Beratungsleistungen in einem Internetauktionshaus verstößt nicht gegen das in § 49b Abs. 3 Satz 1 BRAO geregelte Verbot. Bei Internetauktionen erhält das Auktionshaus zwar neben einer Angebotsgebühr auch eine vom Höchstgebot abhängige Provision, so dass die zu zahlende Provision der Höhe nach vom konkreten Auftrag abhängig ist. Die Provision wird jedoch nicht für die Vermittlung eines Auftrags geschuldet; denn das Internetauktionshaus stellt lediglich das Medium für die Werbung der Anbieter zur Verfügung. Seine Leistung durch das Überlassen einer Angebotsplattform ist vergleichbar mit den Leistungen der herkömmlichen Werbemedien (BVerfG, Beschluss vom 19.02.2008 – 1 BvR 1886/06, NJW 2008, 1298, beck-online). Online-Vermittlungsplattformen, die gegen Provision anwaltliche Dienstleistungen vermitteln, gehen über die Funktion eines klassischen Werbemediums hinaus und sind mit dem vom Bundesverfassungsgericht entschiedenen Sachverhalt nicht vergleichbar (vgl. Behme, AnwBl Online 2018, 110-114). Auch die entgeltliche Vermittlung von Terminsvertretern wird für zulässig gehalten, wenn die erhobene Transaktionsgebühr nicht für die Vermittlung eines Auftrags geschuldet wird, sondern lediglich das Medium für die Vermittlung der Übernahme einer Terminsvertretung zur Verfügung gestellt wird, da die Bereitstellung einer Internetplattform mit den Leistungen herkömmlicher Medien vergleichbar ist (OLG Karlsruhe, Urteil vom 05.04.2013 – 4 U 18/13, NJW 2013, 1614, beck-online). Das Oberlandesgericht München hat bei einer Marketing-Kampagne eine unerlaubte Mandatsvermittlung verneint (Urteil vom 13.10.2021, Az. 7 U 5998/20, DStRE 2022, 505 Rn. 34, beck-online). Nach dem dortigen Vertrag waren aber nur Datensätze von Interessenten zu übermitteln. Ein Lead war dort – anders als hier – nicht mit einer Anwaltsvollmacht verknüpft. Es waren nur Datensätze, nicht aber Vertragsabschlüsse zu liefern, weshalb das Oberlandesgericht München davon ausgegangen ist, dass es sich bei dem Vertragsmodell um eine Form des Dialogmarketings (Direct-Response-Marketing) und damit der Werbung handelt (OLG München, Urteil vom 13.10.2021 – 7 U 5998/20, DStRE 2022, 505 Rn. 34, beck-online). Der Vergleich der Beklagten mit dem Portal anwalt.de geht fehl. Dort handelt es sich um eine Werbeplattform für Anwälte, auf der die Mandanten einen Anwalt suchen, d.h. selbst auswählen können. Bei advocado.de und klugo.de werden ebenfalls Anwälte aus Partnerkanzleien vermittelt; zu den zwischen dem Portal und den Partnerkanzleien vereinbarten Konditionen ist aber nichts bekannt. Es ist insbesondere nicht ersichtlich, ob die Anwälte mandatsbezogen oder erfolgsunabhängig Zahlungen leisten.
(2) Ist das zu zahlende Entgelt kausal mit der Vermittlung eines konkreten Mandats verknüpft, wird von der Rechtsprechung ein Verstoß gegen das Provisionsverbot angenommen. Das Landgericht Berlin hat (rechtskräftig) zum Anwaltsvermittlungsportal axxxxxx.de entschieden, dass die entgeltliche Vermittlung von Mandaten an Rechtsanwälte aufgrund der vom Ratsuchenden abgegebenen Sachverhaltsschilderung unabhängig davon, ob der Betreiber Rechtsanwalt ist, einen sittenwidrigen Wettbewerbsverstoß darstellt, weil hierdurch sowohl § 49b Abs. 3 Satz 1 BRAO als auch Art. 1 § 1 Abs. 1 Satz 1 RBerG verletzt werden (LG Berlin, Urteil vom 07.11.2000 – 102 O 152/00 –, juris). Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat einen Fall entschieden, der eine Kooperationsvereinbarung zum Gegenstand hatte. Diese sah vor, dass der Kläger Mandate von Kapitalanlegern akquirierte und diese außergerichtlich allein betreute. Das damit einhergehende Honoraraufkommen sollte ihm allein zufließen. Sollte eine außergerichtliche Einigung nicht erzielt werden können, sollte der Kläger dem Beklagten betroffene Mandanten namhaft machen. Der Kläger sollte in diesem Fall einen Anteil an den Gebühren für die gerichtliche Vertretung erhalten. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat eine unzulässige Gebührenteilung angenommen, denn der Kläger wurde am Gebührenaufkommen eines Mandats beteiligt, aus dem ihm aus dem Anwaltsvertrag, welchen nur der Beklagte mit dem Mandanten geschlossen hatte, kein Anspruch zustand. Die Vereinbarung der Gebührenteilung sollte unabhängig davon sein, ob der Kläger tatsächlich tätig geworden ist; sie sollte vielmehr allein von der „Vermittlung“ abhängig sein (OLG Düsseldorf Urteil vom 11.01.2022 – I-24 U 184/19, NJW-RR 2022, 778 Rn. 28, beck-online). Eine erfolgsabhängige, prozentual anhand des eingebrachten Honorars bemessene Provisionszahlung spricht für die Vermittlung eines konkreten Mandats, wohingegen eine feste Gebühr unabhängig vom Zustandekommen eines Mandatsvertrags eher für die Vereinbarung eines Aufwendungsersatzes spricht (vgl. El-Auwad, AnwBl Online 2018, 115).
(3) Daran gemessen verstößt das von den Parteien praktizierte Geschäftsmodell in der gewählten Form gegen das Provisionsverbot. Die Klägerin versucht darzulegen, dass ihre Dienstleistungen nicht in der Mandatsvermittlung liegen, sondern sie im Ergebnis nur Interessenten zusammenbringe und eine Infrastruktur vergütungspflichtig bereitstelle. Es handele sich nicht um die Vermittlung von Aufträgen, sondern um das Erfassen von Daten, deren Nutzung den Beteiligten (Kanzlei und Interessent) die Möglichkeit eröffne, miteinander Verträge zu schließen. Dieses Zusammenbringen von Interessent (Betroffener in einem Bußgeldverfahren) und Partnerkanzlei ist aber in der konkreten Ausgestaltung durch die Parteien nichts anderes als eine Vermittlung von Mandaten, weil der sog. Lead erst an die Partnerkanzlei weitergeleitet wird, wenn der Interessent die Vollmacht eingereicht hat und weil eine Vergütung an das konkrete Mandat anknüpft. Soweit die Klägerin der Meinung ist, auf ein Zustandekommen eines Mandats nach Akteneinsicht habe sie keinen Einfluss, mag das richtig sein, es ändert aber nichts daran, dass sie Mandate vermittelt, nämlich bereits solche zur Akteneinsicht und damit zur außergerichtlichen Vertretung. Darauf weist die Beklagte zutreffend hin. Beide Parteien tragen vor, der von der Klägerin generierte Lead erreiche nur dann die Partnerkanzlei, wenn der Interessent die Vollmacht der Partnerkanzlei, die ihm von der Klägerin elektronisch übersandt wird, an die Klägerin zurücksende.“