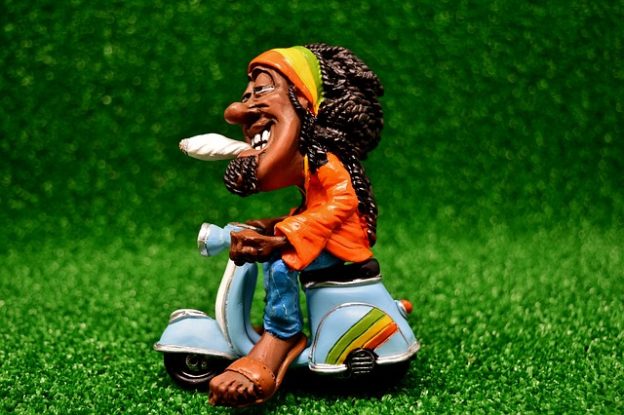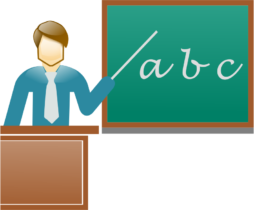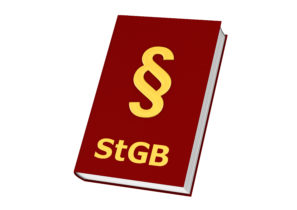Und das zweite Posting kommt dann auch zu einem BayObLG-Beschluss. Das AG hat den Angeklagten wegen Beleidigung zu einer nicht zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt. Das LG hat die hiergegen eingelegte Berufung des Angeklagten als unbegründet verworfen. Dagegen die Revision, die beim BayObLG wegen des Schuldspruchs keinen Erfolg hatte. Insoweit hatte ich den BayObLG, Beschl. v. 15.08.2023 – 204 StRR 292/23 – schon vorgestellt (vgl. Beleidigung II: Sie „Schwuchtel“ und „Wichser“, oder: Schmähkritik, Schmähung, Formalbeleidigung?).
Zur Strafzumessung führt das BayObLG in dem Fall betreffend die verhängte Freiheitsstrafe von (nur) drei Monaten aus:
2. Die Revision des Angeklagten hat aber mit der erhobenen Sachrüge in Bezug auf den Rechtsfolgenausspruch Erfolg.
a) Das Berufungsgericht hat im Rahmen der Strafzumessung die Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe als unerlässlich angesehen, weil nur durch diese Strafe die Einwirkung auf den Täter erreicht werden könne (§ 47 Abs. 1 StGB). Dies hat es unter anderem damit begründet, dass der Angeklagte in der Berufungshauptverhandlung mehr als deutlich gemacht habe, dass er sich keiner Schuld bewusst sei und sich zu Unrecht verfolgt fühle, jegliche Verantwortung für sein eigenes Verhalten ablehne und die Schuld für den Vorfall allein beim Geschädigten sehe. Aus dieser Einstellung des Angeklagten sei der Schluss zu ziehen gewesen, dass er auch in der Zukunft nicht bereit sein werde, sein eigenes Verhalten zu reflektieren und sich vor allem regelkonform zu verhalten. Dies zeige letztlich auch sein Verhalten während des Plädoyers der Staatsanwältin, als er im Sitzungssaal anfing, Cannabis zu inhalieren, und sich auch von der Vorsitzenden hiervon – mit dem Argument, dass ihm das ärztlich verordnet sei, er es jederzeit und überall tun dürfe und man ihm nichts vorschreiben könne – nicht habe abhalten lassen.
b) Diese Strafzumessungserwägungen sind nicht frei von Rechtsfehlern.
aa) Eine kurze Freiheitsstrafe kann u.a. verhängt werden, wenn dies zur Einwirkung auf den Täter unerlässlich ist, weil nur durch diese Strafe die Einwirkung auf den Täter erreicht werden kann (§ 47 Abs. 1 StGB). Damit ist die spezialpräventive Funktion der Strafe gemeint, so dass der Richter zu klären hat, ob eine täterungünstige Prognose (drohende weitere Straftaten) die Freiheitsstrafe erfordert (Schönke/Schröder/Kinzig, 30. Aufl. 2019, StGB § 47 Rn. 11).
bb) Bei den zu berücksichtigenden besonderen Umständen in der Persönlichkeit des Täters darf zwar sein Nachtatverhalten, wie etwa ein Geständnis oder die Tatreue, berücksichtigt werden (vgl. BGH, Urteil vom 08.05.1996 – 3 StR 133/96 –, NStZ 1996, 429, juris Rn. 3). Soweit auf die mangelnde Schuldeinsicht abgestellt wird, verkennt das Berufungsgericht aber, dass das Bestreiten der Tat dem Angeklagten nicht als Uneinsichtigkeit angelastet werden darf, solange er die Grenzen zulässiger Verteidigung nicht überschreitet [vgl. zur Strafzumessung allgemein BGH, Beschluss vom 07.11.1986 – 2 StR 563/86 –, NStZ 1987, 171, juris Rn. 5; zu § 47 Abs. 1 StGB im besonderen BayObLG, Beschluss vom 11.01.1996 – 3St RR 105/95 –, wistra 1996, 236, juris Rn. 29 f.; KG, Beschluss vom 28.02.2001 – (4) 1 Ss 22/01 (23/01) –, juris Rn. 6 m.w.N.]. Der Vorwurf mangelnder Schuldeinsicht und Reue lässt somit besorgen, dass das Landgericht dem Angeklagten sein Verteidigungsverhalten strafschärfend angelastet hat (vgl. BGH, Urteil vom 24.07.1985 – 3 StR 127/85 –, NStZ 1985, 545, juris Rn. 8 f.; OLG Frankfurt, Beschluss vom 27.04.2005 – 2 Ss 78/05 –, juris Rn. 6 m.w.N.). Eine andere Bewertung ist nur zulässig, wenn der Angeklagte bei seiner Verteidigung ein Verhalten an den Tag legt, das im Hinblick auf die Art der Tat und die Persönlichkeit des Täters auf besondere Rechtsfeindschaft und Gefährlichkeit schließen lässt (vgl. BGH, Beschlüsse vom 07.11.1986 – 2 StR 563/86 –, NStZ 1987, 171, juris Rn. 5, und vom 24.07.1985 – 3 StR 127/85 –, NStZ 1985, 545, juris Rn. 9). Ob die richterliche Überzeugung dahin geht, muss das Urteil deutlich erkennen lassen [vgl. KG, Beschluss vom 28.02.2001 – (4) 1 Ss 22/01 (23/01) –, juris Rn. 6 m.w.N.].
Das Berufungsgericht geht zwar davon aus, dass der Angeklagte auch künftig nicht bereit sein wird, sein eigenes Verhalten zu reflektieren und sich regelkonform zu verhalten. Hierbei übersieht es aber, dass es sich vorliegend um die erste Verurteilung wegen eines Äußerungsdelikts handelt und diese letztlich auf einer umfangreichen Abwägung der Umstände des Einzelfalles beruht, die das Berufungsgericht selbst nur unzureichend vorgenommen hat. Unter diesen Umständen können aus der fehlenden Schuldeinsicht keinesfalls Schlüsse auf besondere Umstände in der Täterpersönlichkeit gezogen werden, die die Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe unerlässlich machen.
cc) Darüber hinaus durfte das Berufungsgericht das Verhalten des Angeklagten – Inhalieren von Cannabis während des Plädoyers der Staatsanwältin – nicht ohne weitere Aufklärung bei der Strafzumessung zu Lasten des Angeklagten berücksichtigen. Bei den Feststellungen zu den persönlichen Verhältnissen hat das Berufungsgericht ausgeführt, dass der Angeklagte Cannabispatient ist. Hierauf hat dieser – so die Urteilsfeststellungen – auch hingewiesen, als er von der Vorsitzenden aufgefordert wurde, das Inhalieren von Cannabis während des Plädoyers der Staatsanwältin zu unterlassen. Das Berufungsgericht war demgemäß – wollte es den Umstand des Inhalierens von Cannabis während der Hauptverhandlung zu Lasten des Angeklagten verwerten – gehalten, aufzuklären, ob und unter welchen Voraussetzungen bzw. in welchen zeitlichen Abständen es medizinisch indiziert war, Cannabis zu inhalieren, oder ob der Angeklagte Cannabis während der Hauptverhandlung nur deshalb inhaliert hatte, um das Gericht zu provozieren.“