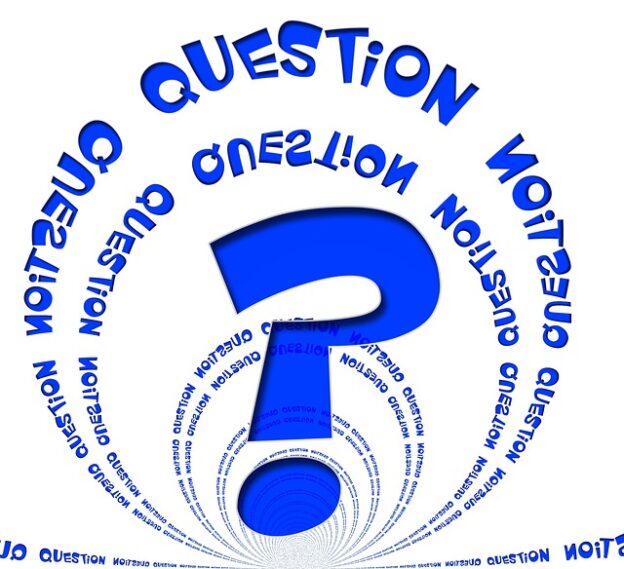In die 29. KW./2024 starte ich heute dann mit einigen Entscheidungen zum beA. Das sind weitgehend BGH-Entscheidungen, eine der vorgestellten Entscheidungen stammt aber vom OLG Düsseldorf.
Hier sind dann also:
- BGH, Beschl. v. 05.06.2024 – 4 StR 157/24 – zum sog. sicheren Übrmittlungsweg (§ 32d Abs. 3 und 4 StPO) für „einfach signierte“ Schriftsätze:
„bb) Ihre einfach signierten Schriftsätze hat die Verteidigerin nicht auf dem hier einzig in Betracht kommenden sicheren Übermittlungsweg zwischen ihrem besonderen elektronischen Anwaltspostfach und der elektronischen Poststelle des Landgerichts eingereicht ( § 32a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 StPO ).
Das Adjektiv „sicher“ bezieht sich insoweit nicht auf Fragen der IT-Sicherheit oder des Ausfallschutzes, sondern darauf, dass aufgrund entsprechender technischer Sicherungsmaßnahmen bei Nutzung eines solchen Übermittlungswegs ein sicherer Rückschluss auf die Identität des Absenders möglich ist (vgl. BGH, Beschluss vom 8. September 2022 – 3 StR 251/22 Rn. 6). Der besondere Kommunikationskanal ersetzt die Identifikationsfunktion der Unterschrift (Müller, NZS 2018, 207, 209). Den hiermit verbundenen Anforderungen werden die Eingaben der Verteidigerin nicht gerecht. Die erforderliche eigenhändige Versendung aus dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach wird durch den vertrauenswürdigen Herkunftsnachweis (vHN) dokumentiert. Dieser wird nur an einer Nachricht angebracht, wenn das Postfach in einem sicheren Verzeichnisdienst geführt wird und der Postfachinhaber zu dem Zeitpunkt, zu dem die Nachricht erstellt wird, sicher an dem Postfach angemeldet ist (vgl. BAGE 171, 28 Rn. 27; Müller, NZS 2018, 207, 209; Biallaß, NJW 2021, 789 [OLG Oldenburg 09.12.2020 – 6 W 68/20] ). Beim Empfänger führt die Übersendung dann zu dem Prüfergebnis „sicherer Übermittlungsweg aus einem besonderen Anwaltspostfach“. Der vHN ist maßgeblich für die freibeweisliche Prüfung einer formgerechten Einreichung. Fehlt er, kann nicht von einem Eingang auf einem sicheren Übermittlungsweg im Sinne von § 32a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 StPO ausgegangen werden (vgl. BGH, Beschluss vom 25. Oktober 2023 – 4 StR 313/23 Rn. 2, 5; Beschluss vom 7. Februar 2023 – 2 StR 162/22 Rn. 6; s. auch BVerwG, NVwZ 2022, 649 [BVerwG 12.10.2021 – BVerwG 8 C 4.21] Rn. 6 ff.; BAGE 171, 28 [BAG 05.06.2020 – 10 AZN 53/20] Rn. 25 ff.). So liegt es hier. Denn die Prüfvermerke des Landgerichts weisen aus, dass die Revision und ihre Begründung lediglich „per EGVP“ übersandt wurden.
- BGH, Beschl. v. 15.05.2024 – 3 StR 450/23 – zur ggf. erforderlichen Ergänzung der Urteilsgründe:
Ist die Revision wirksam elektronisch übermittelt worden, wegen technischer Störungen aber nicht zu den Sachakten gelangt, und hat das erkennende Gericht in Vertrauen auf die Rechtskraft der Entscheidung die Urteilsgründe abgekürzt abgefasst, kann es diese entsprechend § 267 Abs. 4 S. 4 ergänzen, wenn es vom Eingang des Rechtsmittels erfährt. Sofern dem Gericht zu diesem Zeitpunkt die Akten nicht mehr vorliegen, beginnt die Frist zur Absetzung des ergänzten Urteils mit erneutem Eingang der Akten.
- BGH, Urt. v. 09.01.2024 – 2 StR 262/23 – zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Nachholung von Verfahrensrügen:
Dem Angeklagten ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist zur Erhebung von Verfahrensrügen zu gewähren, wenn er glaubhaft gemacht hat, dass seinem Verteidiger am letzten Tag der Revisionsbegründungsfrist um 23.49 Uhr die Übersendung einer fertiggestellten ergänzenden Revisionsbegründung zur Anbringung der Verfahrensrügen als elektronisches Dokument über sein besonderes elektronisches Anwaltspostfach nicht möglich war, weil das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des jeweiligen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen – was dem Verteidiger im Zeitpunkt des Übersendungsversuchs noch nicht bekannt war – in der Weise gestört war, dass die Gerichte und Behörden elektronische Dokumente nicht empfangen konnten. Denn dadurch war der Verteidiger durch ausschließlich im Bereich der Justiz gründende Umstände gehindert, eine die fristgemäß erhobene Sachrüge ergänzende Verfahrensrüge rechtzeitig formgerecht anzubringen (vgl. zum gestörten Empfangsgerät im Bereich der Justiz BGH, Beschluss vom 18. Juni 2008 – 2 StR 485/07, NStZ 2008, 705).
- BGH, Beschl. v. 29.05.2024 – I ZB 84/23– zur Dokumentation des Zustelldatums:
Ein Rechtsanwalt muss Vorkehrungen dafür treffen, dass ein Zustellungsdatum, das in einem von ihm abgegebenen elektronischen Empfangsbekenntnis eingetragen ist, auch in seiner – noch in Papierform geführten – Handakte dokumentiert wird. An die Zustellung anknüpfende Fristen müssen anhand der Angaben im elektronischen Empfangsbekenntnis berechnet werden.
- OLG Düsseldorf, Urt. v. 18.4.2024 – 2 U 59/23 – zur vorübergehenden technischen Unmöglichkeit und zur unverzüglichen Ersatzeinreichung
-
- Im Falle einer Ersatzeinreichung hat die Glaubhaftmachung der vorübergehenden technischen Unmöglichkeit der elektronischen Übermittlung des Dokuments nach § 130d S. 3 ZPO möglichst gleichzeitig mit der Ersatzeinreichung zu erfolgen. Eine unverzügliche Nachholung kommt ausschließlich dann in Betracht, wenn der Rechtsanwalt das technische Defizit erst kurz vor Fristablauf bemerkt und ihm daher nicht mehr genügend Zeit für die gebotene Darlegung und Glaubhaftmachung in dem ersatzweise einzureichenden Schriftsatz verbleibt.
- Die Mitteilung der Gründe für die Ersatzeinreichung nach mehr als einer Woche ist im Regelfall nicht mehr unverzüglich i.S.d. § 130d Satz 3 ZPO.
- Die Bekanntheit einer technischen Störung auf Seiten des Gerichts entbindet den Einreicher jedenfalls nicht gänzlich davon, die Ursächlichkeit der Störung für die Übermittlung in Papierform oder per Telefax glaubhaft zu machen (Anschluss an OLG Hamm, Beschl. v. 03.07.2023 – 31 U 71/23, NJOZ 2023, 1582).