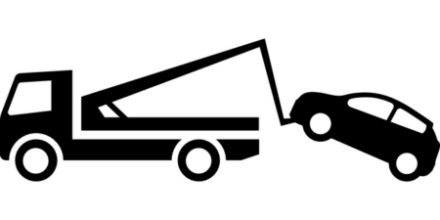Bild von Peggy und Marco Lachmann-Anke auf Pixabay
Im Kessel Buntes dann heute zwei Entscheidungen zur sog. erkennungsdiesntlichen Behandlung nach § 81b StPO und der Löschung etwaiger Ergebnisse nach Beendigung des Verfahrens. Ein Bereich, in dem es und um den es immer wieder Diskussionen gibt.
Ich beginne mit dem OVG Sachsen, Beschl. v. 16.06.2020 – 3 A 346/20, dem folgender Sachverhalt zugrunde liegt:
Gegen den Kläger ist gem. § 81b Alt. 2 StPO die erkennungsdienstliche Behandlung des Klägers „in Form der Anfertigung eines Ganzkörperbilds, Dreiseitenbilds, Detailbilds, einer Personenbeschreibung, „Messen und Wiegen“, Zehn-Finger- und Handflächenabdrucks angeordnet [worden]. Zur Begründung zog der Beklagte ein bei der Polizeidirektion D. im Jahr 2015 eröffnetes Ermittlungsverfahren u. a. wegen Landfriedensbruchs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung heran. Dem Kläger wird hierin vorgeworfen, aus einer Gruppe von etwa elf Personen heraus in der Nacht vom 00. auf den 00.00.0000 in D. körperliche Angriffe gegen eine Gruppe von Geschädigten ausgeübt und diese auch beleidigt zu haben. Gegen den daraufhin erlassenen Strafbefehl des Amtsgerichts D. vom 00.00.0000 legte der Kläger Einspruch ein. Gegen den Kläger sind ausweislich einer im Widerspruchsbescheid enthaltenen Übersicht (S. 2 f. des Widerspruchsbescheids) zwischen 2003 sowie 2014 15 Ermittlungs- oder Strafverfahren geführt worden. Die Verfahren wurden mit Verurteilungen zu Geldstrafen abgeschlossen oder gemäß §§ 153, 154, 170 Abs. 2 StPO als Bagatellsachen, als unwesentliche Nebenstraftat oder mangels Nachweisbarkeit der Täterschaft eingestellt.“
Das VG hat die Klage des Klägers abgewiesen. Dagegen dann der Antrag auf Zulassung der Berufung, den das OVG zurückgewiesen hat:
„2. Die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts ist nicht wegen ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit des Urteils zuzulassen.
Zweifel im Sinne der genannten Vorschrift bestehen dann, wenn ein tragender Rechtssatz oder eine erhebliche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt wird (BVerfG, Kammerbeschl. v. 21. Dezember 2009 – 1 BvR 812/09 -, NJW 2010, 1062) und sich das angegriffene Urteil im Ergebnis nicht aus anderen Gründen als offensichtlich richtig erweist (BVerwG, Beschl. v. 10. März 2004 – 7 AV 4.03 -, juris Rn. 7 ff.).
Der Kläger trägt hierzu mit Schriftsatz vom 28. April 2020 vor: Die Tatsache, dass ihm gegenüber ein noch nicht rechtskräftiger Strafbefehl ergangen sei, zeige, dass der Vorwurf offensichtlich nicht schwer sei. Er sei bislang nur dreimal wegen ersichtlicher Bagatellkriminalität verurteilt worden; die übrigen Verfahren seien aus verschiedenen Gründen eingestellt worden. Es sei falsch, dass noch ein „Restverdacht“ gegeben sei. Das Gesetz kenne den Begriff der erwiesenen Unschuld nicht. Die Tatsache, dass seit 2016 keine Verfahren mehr anhängig gemacht worden seien, zeige, dass sich seine Lebenssituation und die Einstellung zu Regelverstößen geändert hätte. Die Schlussfolgerung einer „rechten Gesinnung“ lasse sich aus dem Sachverhalt nicht ableiten, sondern sei reine Spekulation über die rechtlich letztlich nicht bedeutsame Gesinnung im Zusammenhang mit nicht nachgewiesener Täterschaft wegen einer nicht aufklärbaren Straftat. Es handelt sich um einen klassischen Zirkelschluss. Es werde vom Gericht nicht belastbar dargestellt, aus welchen Tatsachen sich tatsächlich die unterstellte Befürchtung weiterer Straftaten ergeben solle. Die Vorteile einer erkennungsdienstlichen Behandlung seien derart allgemein gehalten, dass sie letztendlich auf jedermann zutreffen könnten. Die Sache habe wegen des erheblichen Grundrechtseingriffs gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und die Missachtung der Unschuldsvermutung erhebliche Bedeutung.
Das Vorbringen rechtfertigt keine Zulassung der Berufung. Die Prognose des Beklagten ist nicht zu beanstanden, der Kläger werde voraussichtlich auch in Zukunft strafrechtlich in Erscheinung treten.
Mit dem Verwaltungsgericht ist der Senat der Auffassung, dass die Anlasstat und die weiteren gegen den Kläger geführten Ermittlungs- und Strafverfahren die Annahme einer Wiederholungsgefahr rechtfertigen. Dabei können auch Ermittlungsverfahren herangezogen werden, die nicht wegen erwiesener Unschuld gemäß § 170 Abs. 2 StPO, sondern mangels Nachweises der Tat oder aus anderen Gründen eingestellt worden sind (SächsOVG, Beschl. v. 6. Februar 2017 – 3 A 862/16 -, juris Rn. 9 m. w. N.). Aufgrund der präventiv-polizeilichen Ausrichtung der erkennungsdienstlichen Behandlung entfällt die Notwendigkeit von erkennungsdienstlichen Maßnahmen nicht von Vornherein infolge derartiger Verfahrenseinstellungen, mithin bei Ermittlungs- und Strafverfahren, die nicht wegen erwiesener Unschuld des Klägers zur Einstellung gelangt sind. Behörde und Gericht müssen sich unter sorgfältiger Würdigung aller Umstände des Falls damit auseinandersetzen, aus welchen Gründen eine erkennungsdienstliche Behandlung dennoch notwendig ist (st. Rspr.; vgl. SächsOVG, Urt. v. 19. April 2018 – 3 A 215/17 -, juris Rn. 22 m. w. N.; BVerwG, Urt. v. 27. Juni 2018 – 6 C 39/16 -, juris Rn. 23 m. w. N.). Die Berücksichtigung auch solcher Ermittlungsverfahren verstößt nicht gegen die strafrechtliche Unschuldsvermutung (hierzu im Einzelnen SächsOVG, Beschl. v. 5. Mai 2014 – 3 A 82/13 -, juris Rn. 5 m. w. N.). Davon ausgehend hat das Gericht insbesondere die erkennbaren Lebensumstände des Klägers und seine gegenüber seiner Prozessbevollmächtigten gemachten Äußerungen herangezogen. Zur Vermeidung von Wiederholungen verweist der Senat auf die diesbezüglichen Ausführungen des Verwaltungsgerichts (§ 122 Abs. 2 Satz 3 VwGO; S. 7-9 der Urteilsgründe).
Schließlich ändert an dem Ergebnis auch nichts, dass es sich angeblich bei mehreren strafrechtlichen Ermittlungsverfahren nur um Bagatellkriminalität gehandelt haben soll. Denn – auch hierauf hat das Verwaltungsgericht zutreffend hingewiesen – der Kläger ist nicht nur allein im Bereich von Bagatelldelikten auffällig geworden, sondern insbesondere auch mit Körperverletzungsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Tankbetrugs und Fahren ohne Fahrerlaubnis und damit mit von einem erheblichen Unrechtsbewusstsein geprägten Straftatsvorwürfen.
Auch die vom Verwaltungsgericht gebilligte Prognose des Beklagten ist nicht zu beanstanden. Dabei hat es nicht entscheidungserheblich auf die mögliche (rechte) Gesinnung des Klägers abgestellt, sondern darauf, dass auch nach seinen von seiner Prozessvertreterin in der mündlichen Verhandlung mitgeteilten Äußerungen ihr gegenüber der Kläger auch heute noch Teil eines Freundeskreises ist, den er selber als „falsche Leute“ bezeichnet und wegen derer er in „ein Fadenkreuz hineingeraten“ sei. Die Schlussfolgerung des Verwaltungsgerichts, dass mangels ausreichender Distanzierung von seinem bisherigen Freundeskreis auch in Zukunft mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit die Begehung von Straftaten zu erwarten sei, ist unter diesen Vorgaben durchaus naheliegend. Schließlich geht es zu Lasten des Klägers, wenn er die empfohlene Teilnahme an der mündlichen Verhandlung nicht dafür genutzt hat, zur weiteren Aufklärung seiner derzeitigen Lebensverhältnisse zur Verfügung zu stehen. Angesichts dessen kann keine Rede davon sein, dass das Verwaltungsgericht nur Spekulationen angestellt und nur allgemein gehaltene Vermutungen abgegeben habe. Auch ist die Feststellung des Verwaltungsgerichts nachvollziehbar, dass allein der bisherige etwa dreijährige Zeitraum, in dem der Kläger strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung getreten ist, zu kurz sei, um von einer gefestigten Veränderung der Lebensumstände und damit von einer nicht mehr bestehenden Wiederholungsgefahr auszugehen.“
 Und die zweite Entscheidung kommt mit dem OVG Sachsen, Beschl. v. 14.09.2023 – 6 B 113/23 – aus Sachsen.
Und die zweite Entscheidung kommt mit dem OVG Sachsen, Beschl. v. 14.09.2023 – 6 B 113/23 – aus Sachsen.