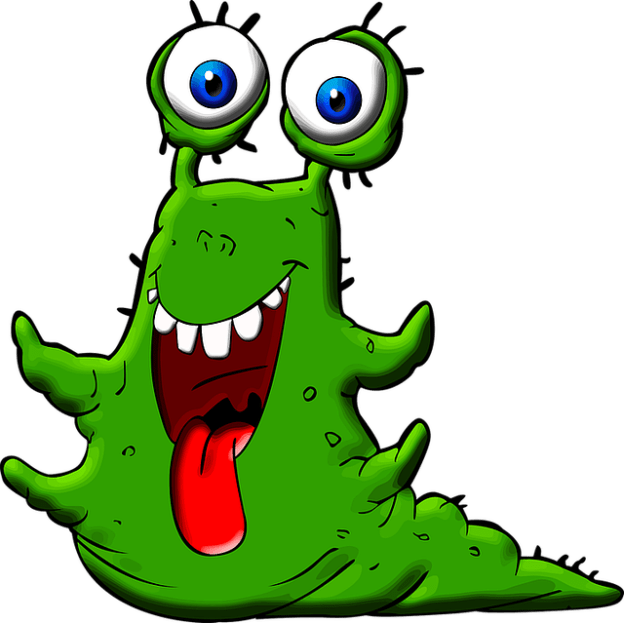Im zweiten Posting dann mal wieder eine Entscheidung zur Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (§ 201 StGB) mit einer ganz interessanten Sachverhaltsvariante. Das LG Hanau geht nämlich im LG Hanau, Beschl. v. 20.04.2023 – 1 Qs 23/22 -, in dem es die Beschlagnahme eines Mobiltelefons aufgehoben hat, von folgendem Sachverhalt aus:
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen mit drei männlichen Personen besetzten Fahrzeuges, in dem sich der Beschuldigte befand, kamm es zu einer Diskussion mit den Polizeibeamten. Im Verlauf dieser Diskussion startete der eine POK mit seiner dienstlich mitgeführten „Body-Cam“ eine Ton- und Videoaufnahme, nachdem er diese gegenüber dem Beschuldigten angekündigt hatte. Daraufhin begann der Beschuldigte seinerseits, den Beamten und dessen weitere Anordnungen mit seinem – beschwerdegegenständlichen – Mobiltelefon zu filmen, wobei nach dem Stand der Ermittlungen unklar ist, ob tatsächlich eine erfolgreiche Aufnahme erfolgte.
Der Polizeibeamte forderte den Beschulidgten auf, das Filmen mit seinem Mobiltelefon zu unterlassen, da er sich strafbar mache und ihm sonst das Mobiltelefon abgenommen würde. Er erklärte ihnen daraufhin, dass sich das angefertigte Video „schon in der Cloud“ befinden würde. Die Beamten nahmen sodann telefonisch Kontakt zu dem Bereitschaftsstaatsanwalt auf, woraufhin dieser die Sicherstellung des Mobiltelefons anordnete. Der Beschuldigte händigte sein Mobiltelefon nach mehrfacher Aufforderung an die Polizeibeamten aus und forderte von den Beamten eine richterliche Entscheidung.
Das AG hat die erfolgte Beschlagnahme des Mobiltelefons bestätigt und sich dabei auf § 201 Abs. 1 Nr. 1 StG. Dagegen die Beschwerde, die beim LG Erfolg hatte:
„Die Beschwerde ist auch begründet. Die als Bestätigung der polizeilichen Beschlagnahme zu verstehende Anordnung der Beschlagnahme des Mobiltelefons und der Silikonhülle auf den Widerspruch des Beschwerdeführers durch das Amtsgericht war rechtsfehlerhaft, weil die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 94, 98 Abs. 2 S. 1 StPO nicht vorliegen. Es fehlt nach geltender Gesetzeslage an einem Anfangsverdacht für strafbares Verhalten des Beschwerdeführers. Denn es besteht auch auf der Grundlage des von dem Beschwerdeführer eingeräumten Sachverhaltes kein Verdacht dafür, dass der Beschwerdeführer unbefugt das nichtöffentlich gesprochene Wort der Polizeibeamten während der Kontrolle auf einen Tonträger aufgenommen hat oder dies versuchte (§ 201 Abs. 1, Abs. 4 StGB). Zwar hat der Beschwerdeführer in diesem Sinne eine taugliche Tathandlung vorgenommen, weil er nach eigenem Bekunden eine solche Aufnahme mittels der Speichertechnologie seines Mobiltelefons hergestellt und auf einem sog. Cloudspeicher abgelegt hat.
Allerdings hat er damit nicht das nichtöffentlich gesprochene Wort des Polizeibeamten aufgenommen. Nach bisherigem Verständnis in Rechtsprechung und Literatur gilt eine Äußerung als nichtöffentlich i.S.d. § 201 Abs. 1 StGB, wenn sie nicht für einen größeren, nach Zahl und Individualität unbestimmten oder nicht durch persönliche oder sachliche Beziehungen miteinander verbundenen Personenkreis bestimmt oder unmittelbar verstehbar ist (OLG Frankfurt a.M., NJW 1977, 1547; OLG Düsseldorf, Urteil vom 04.11.2022 – 3 RVs 28/22, BeckRS 2022, 31267; Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kargl, 5. Aufl. 2017, § 201 Rn. 8; Schönke/Schröder/Eisele, 30. Aufl. 2019, § 201 Rn. 6; MüKoStGB/Graf, 4. Aufl. 2021, § 201 Rn. 14; Fischer, 69. Aufl. 2022, § 201 Rn. 3; Lackner/Kühl/Heger/Heger, 30. Aufl. 2023, § 201 Rn. 2; BeckOK StGB/Heuchemer, 56. Ed. 1.2.2023, StGB § 201 Rn. 4 m.w.N.). Bei polizeilichen Personenkontrollen wird einschränkend keine Nichtöffentlichkeit angenommen, wenn die Kontrolle im Rahmen von Demonstrationen mit zahlreichen umstehenden Personen erfolgt (vgl. Ullenboom, Das Filmen von Polizeieinsätzen als Verletzung der Vertraulichkeit des Worts?, NJW 2019, 3108, 3110). Zum Teil wird eine den objektiven Tatbestand noch weiter einschränkende Auslegung als „faktische Öffentlichkeit“ bei Personenkontrollen auch dann angenommen, wenn mit einer Kenntnisnahme durch Dritte gerechnet werden muss, beispielsweise also dann, wenn der betroffene Polizeibeamte sich lautstark äußert und daher anzunehmen sei, dass mehrere umstehende Personen das gesprochene Wort hören können (so: LG Kassel, Beschluss vom 23.09.2019 – 2 Qs 111/19, BeckRS 2019, 38252; LG Hamburg, Beschluss vom 21.12.2021 – 610 Qs 37/21 jug., BeckRS 2021, 44380). Noch enger meinen das Oberlandesgericht Zweibrücken (Beschluss vom 30.06.2022 – 1 OLG 2 Ss 62/21, NJW 2022, 3300), das Landgericht Aachen (Beschluss vom 19.08.2020 – 60 Qs 34/20, BeckRS 2020, 43645) sowie das Oberlandesgericht Düsseldorf (Urteil vom 04.11.2022 – 3 RVs 28/22, BeckRS 2022, 31267) eine faktische Öffentlichkeit bereits dann annehmen zu müssen, wenn der äußernde Polizeibeamte in Anbetracht der konkreten Äußerungsumstände allein damit habe rechnen müssen, dass unbeteiligte dritte Personen die Äußerungen mithören könnten.
Selbst gemessen an diesen engen Anforderungen waren die Äußerungen des Polizeibeamten pp. im Ausgangspunkt nichtöffentlich und deshalb für eine Täterschaft des Beschwerdeführers geeignet. Denn die Kontroll- und Gesprächssituation mit Personen, die sich nachts um 00.40 Uhr in einem Fahrzeug befinden und mit denen zwei Polizeibeamte durch die geöffneten Türen oder Fenster kommunizieren, ist selbst für einen zufällig passierenden Fußgänger gerade einmal in Gesprächsfetzen inhaltlich verfolgbar, solange er sich nicht in unmittelbarer Nähe dazu stellt, um aktiv mitzuhören. Diese Begrenztheit des Personenkreises ist allen Beteiligten einer solchen nächtlichen Fahrzeug- und Personenkontrolle auch bewusst. Das war bei der verfahrensgegenständlichen Kontrolle nicht anders.
Es kann für die weitere rechtliche Bewertung offen bleiben, inwieweit das Gespräch seinen nichtöffentlichen Charakter bereits allgemein dadurch verlor, dass es sich um eine polizeiliche Maßnahme handelte (eine Anwendbarkeit des § 201 StGB auf dienstliche Verlautbarungen von Polizeibeamten im Allgemeinen zumindest infrage stellend: LG Aachen, Beschluss vom 19.08.2020 – 60 Qs 34/20, BeckRS 2020, 43645 unter Verweis auf Roggan, Zur Strafbarkeit des Filmens von Polizeieinsätzen – Überlegungen zur Auslegung des Tatbestands von § 201 Abs. 1 Nr. 1 StGB – Zugleich Anmerkung zu LG Kassel, Beschl. v. 23.09.2019 – 2 Qs 111/19, StV 2020, 161 und LG München I, Urt. v. 11.02.2019 – 25 Ns 116 Js 165870/17, StV 2020, 321 -, StV 2020, 328). Das Landgericht Osnabrück (Beschluss vom 24.09.2021 – 10 Qs/120 Js 32757/21 – 49/21, BeckRS 2021, 28838) geht davon aus, dass ein Amtsträger, dessen Handeln rechtlich gebunden ist und als solches einer rechtlichen Überprüfung unterliegt, keines Schutzes der Unbefangenheit bedürfe. Nach der überwiegenden Auffassung in Rechtsprechung und Kommentarliteratur sollen jedoch auch polizeiliche Kontrollen grundsätzlich dem Schutzbereich des § 201 StGB unterfallen (so etwa LG Kassel, Beschluss vom 23.09.2019 – 2 Qs 111/19, BeckRS 2019, 38252; MüKoStGB/Graf, 4. Aufl. 2021, § 201 Rn. 17a; ausführlich bereits OLG Frankfurt a.M., NJW 1977, 1547).
Die nähere Prüfung erübrigt sich deshalb, weil das Gespräch zwischen POK pp. und dem Beschwerdeführer – vergleichbar mit der Fallgruppe einer faktischen Öffentlichkeit – spätestens in dem Moment nicht mehr nichtöffentlich war, als der Beamte – zuvor angekündigt – seine dienstlich gelieferte Body-Cam anschaltete und damit seinerseits das Gespräch zu Beweiszwecken auf ein Speichermedium aufnahm. Wie sich der Einsatz einer polizeilich genutzten Body-Cam auf die Tatbestandsmäßigkeit der Norm auswirkt, ist in der Rechtsprechung bislang nicht entschieden und in der Literatur nur am Rande diskutiert worden. Eine solche Gesprächssituation nimmt nach Auffassung der Kammer gemessen an Wortlaut, Entstehungsgeschichte und insbesondere dem Strafzweck des § 201 StGB nicht mehr an dessen Schutz teil.
Schutzgut bzw. Normzweck des § 201 StGB ist der Schutz der Privatsphäre sowie das Recht auf Bestimmung der Reichweite einer Äußerung sowie die Wahrung der Unbefangenheit des gesprochenen Wortes (Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kargl, 5. Aufl. 2017, § 201 Rn. 2 m.w.N.; MüKoStGB/Graf, 4. Aufl. 2021, § 201 Rn. 2 unter Verweis auf die Gesetzesmaterialien; Fischer, 69. Aufl. 2022, § 201 Rn. 3 sowie BeckOK StGB/Heuchemer, 55. Ed. 1.11.2022, StGB § 201 Rn. 1 jeweils mit Verweis u.a. auf BVerfG, Beschluss vom 31.01.1973 – 2 BvR 454/71, NJW 1973, 891 sowie auf BGH, Urteil vom 14.06.1960 – 1 StR 683/59, NJW 1960, 1580). Beruflich und persönlich gesprochene Worte sind gleichermaßen geschützt, weshalb die amtliche Überschrift „Vertraulichkeit“ als zu eng angesehen wird (vgl. Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kargl, 5. Aufl. 2017, § 201 Rn. 3; OLG Karlsruhe, Urteil vom 09.11.1978 – 2 Ss 241/78, NJW 1979, 1513). Zur Veranschaulichung des Schutzzwecks wird angeführt, dass dasjenige, was als flüchtige Lebensäußerung gemeint war, nicht „in eine jederzeit reproduzierbare Tonkonserve verwandelt“ werden dürfe (so u.a. MüKoStGB/Graf, 4. Aufl. 2021, StGB § 201 Rn. 2, Schönke/Schröder/Eisele, 30. Aufl. 2019, StGB § 201 Rn. 2 und Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kargl, 5. Aufl. 2017, § 201 Rn. 2 jeweils unter Berufung auf Gallas, ZStW 75, 16). Auch bei Betrachtung des systematischen Zusammenhanges mit Abs. 2 Nr. 1 der Bestimmung (Abhörgerät) und der Entstehungsgeschichte derselben tritt hervor, dass die Vorschrift die bei ihrem Inkrafttreten noch neuen und deshalb oft unbemerkten technischen Möglichkeiten der Tonaufnahme einhegen und dazu die heimliche Aufnahme vertraulicher Worte im engen Kreis als wesentliches Merkmal von Freiheitsstandards demokratischer Staaten verhindern wollte.
Hier liegt der Fall umgekehrt. Die den Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Anspruch nehmenden Äußerungen stammen gerade von einem Polizeibeamten, der diese nicht nur im hoheitlichen Kontext abgibt, sondern gleichzeitig noch deren bestimmungsgemäße Aufnahme auf gesetzlicher Grundlage herbeiführt. Er rechnet dabei damit, dass die dem Beschwerdeführer mitgeteilte und für etwaige Ermittlungsakten dauerhaft gesicherte Aufnahme zur Folge hat, dass die Worte der Polizeibeamten gerade nicht mehr unbefangen erfolgen können, wie dies bei einer flüchtigen und gerade nicht „reproduzierbar konservierten“ Aussage der Fall ist (vgl. am Rande auch LG Aachen, Beschluss vom 19.08.2020 – 60 Qs 34/20, BeckRS 2020, 43645 unter Verweis auf Roggan, Zur Strafbarkeit des Filmens von Polizeieinsätzen – Überlegungen zur Auslegung des Tatbestands von § 201 Abs. 1 Nr. 1 StGB – Zugleich Anmerkung zu LG Kassel, Beschl. v. 23.09.2019 – 2 Qs 111/19, StV 2020, 161 und LG München I, Urt. v. 11.02.2019 – 25 Ns 116 Js 165870/17, StV 2020, 321 -, StV 2020, 328; Reuschel, Audioaufnahme von polizeilicher Personalienfeststellung, NJW 2022, 3300, 3303). Der betroffene Polizeibeamte wusste im vorliegenden Fall, dass seine Worte zu einem späteren Zeitpunkt von weiteren Ermittlungsbeamten oder einem Gericht abgehört werden können und strebte diese Wirkung der Natur der gewählten Maßnahme entsprechend an, was er als Beweissicherungszweck vor dem Anschalten des Kameragerätes auch ankündigte. In einem solchen Fall liegt nicht unbefangenes Reden auf der Hand, sondern vielmehr das Bemühen um höchst konzentrierte, präzise auf die Ausfüllung des rechtlichen Rahmens abgestimmte Kommunikation. An dieser Bewertung der Unbefangenheit ändert es nichts, dass es der Beamte ist, der über den Beginn und die Dauer der Tonaufnahme entscheidet und mit seiner Anstellungskörperschaft über die weitere Nutzung entscheidet.
Die Kammer sieht sich neben dem Normzweck auch unter dem verfassungsrechtlichen Gesichtspunkt der Bestimmtheit strafrechtlicher Gesetze zu einer normzweckentsprechenden Beschränkung veranlasst. Verlangt wird danach, dass strafrechtliche Normen derart klar sind, dass jedermann vorhersehen kann, welches Verhalten verboten und mit Strafe bedroht ist (BVerfG, Beschluss vom 23.06.2010 – 2 BvR 2559/08 –, juris). Außerdem sollen die wesentlichen Entscheidungen über Strafbarkeit und Strafe bei der Legislative liegen und nicht eigeninitiativ durch Exekutive oder Judikative getroffen werden (Dürig/Herzog/Scholz/Remmert, 99. EL September 2022, GG Art. 103 Abs. 2 Rn. 77) Bedenken ergeben sich bereits bei den übrigen Fällen der faktischen Öffentlichkeit daraus, dass letztlich vom einzelfallbedingten Zufall abhängt, ob eine Kenntnisnahme oder deren Möglichkeit durch Unbeteiligte stattfindet (ähnlich Klefisch, jurisPR-StrafR 6/2021 Anm. 4; Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Kargl, 5. Aufl. 2017, § 201 Rn. 9). Entscheidend treten bei dem Einsatz von Body-Cams Anhaltspunkte für die Annahme hinzu, dass der Bürger sich in einem immer weitergehend von Handybild- und -tonaufnahmen beherrschten Alltag dazu berechtigt sieht, für ihn bedeutsame Ereignisse zu filmen – wenn auch nicht stets verbreiten zu dürfen. Dabei stehen das Interesse der Bürger daran, Polizeiarbeit transparent dokumentieren zu dürfen auf der einen Seite und das Interesse der Polizeibeamten an einer nicht durch das Filmen gestörter Arbeit auf der anderen Seite in einem Spannungsverhältnis. Das polizeiliche Interesse am Unterlassen der Anfertigung von Aufnahmen kann dabei insbesondere vor dem Hintergrund der Gefahr von möglichen ausschnittweisen und aus dem Zusammenhang gelösten Veröffentlichung entsprechender Aufnahmen durchaus denkbar sein, zumal allein die Besorgnis einer solchen Veröffentlichung noch nicht der Regelung des § 33 KUrhG unterfällt. Diesen Interessenwiderstreit zu lösen obliegt indes nicht mehr rechtsfortbildend den Strafgerichten im Wege einer mit dem Bestimmtheitsgrundsatz und dem Schutzzweck der Norm in Widerstreit tretenden Auslegung des Begriffs der Nichtöffentlichkeit. Die konkret bestimmte Androhung von Strafe für die Aufnahme polizeilicher Maßnahmen oder der Verzicht darauf ist deshalb de lege ferenda unter Bewertung der in der Praxis vorgefundenen Phänomene und der widerstreitenden Interessen Sache des Gesetzgebers.
Gemessen an dieser gebotenen normzweckentsprechenden Beschränkung des Tatbestandsmerkmals der Nichtöffentlichkeit kommt es nicht mehr darauf an, ob die Aufnahme aus den soeben beschriebenen Wertungen befugt erfolgte, was etwa im Fall des Vorliegens eines Einverständnisses des aufgenommenen Beamten mit Einschalten der Body-Cam (vgl. allgemein zum Einverständnis i.R.d. § 201 StGB Schönke/Schröder/Eisele, 30. Aufl. 2019, § 201 Rn. 29) oder bei Vorliegen einer Notwehrsituation oder eines rechtfertigenden Notstands denkbar ist (vgl. LG Aachen, Beschluss vom 19.08.2020 – 60 Qs 34/20, BeckRS 2020, 43645 unter Verweis auf Ullenboom, Das Filmen von Polizeieinsätzen als Verletzung der Vertraulichkeit des Worts?, NJW 2019, 3108, 3111). Vorliegend ist allenfalls eine Rechtfertigung über § 34 StGB in Betracht zu ziehen, wobei im Rahmen der dort gebotenen Rechtsgüterabwägung das Persönlichkeitsrecht des aufgenommenen Polizeibeamten dem Beweisinteresse der aufnehmenden Person gegenüberzustellen wäre, sofern überhaupt aufgrund konkreter Anhaltspunkte für ein rechtswidriges polizeiliches Handeln von dem Vorliegen einer Gefahr i.S.d. § 34 StGB ausgegangen werden darf (vgl. Ullenboom, Das Filmen von Polizeieinsätzen als Verletzung der Vertraulichkeit des Worts?, NJW 2019, 3108, 3111; Rennicke, Polizeiliches Einschreiten gegen Filmaufnahmen unter Berücksichtigung der DS-GVO, NJW 2022, 8, 13; LG Aachen, Beschluss vom 19.08.2020 – 60 Qs 34/20, BeckRS 2020, 43645; OLG Zweibrücken Beschluss vom 30.06.2022 – 1 OLG 2 Ss 62/21, NJW 2022, 3300).
Eine Strafbarkeit gem. § 33 KUrhG ist nicht gegeben, da der Beschwerdeführer die Videoaufnahme nicht öffentlich zur Schau gestellt hat. Die Ermittlungen bieten keine Anhaltspunkte dafür, dass eine etwaige Tonaufnahme in sozialen Medien weitergeleitet wurde. Sollte die Aufnahme tatsächlich in den Cloud-Speicher hochgeladen worden sein – was der Beschwerdeführer abstreitet (Bl. 14 d. A.) –, stellt dies kein öffentliches Zurschaustellen i.S.d. § 33 Abs. 1 KUrhG dar, da es sich bei der mutmaßlich verwendeten Cloud um einen privaten, nicht öffentlich einsehbaren Cloud-Speicher handelt. Eine Strafbarkeit nach § 201a Abs. 1 Nr. 2 lit. a) StGB durch Herstellen von Bildaufnahmen scheidet von vornherein aus, da dem Einsatz der Polizeibeamten keine Befassung mit hilflosen Personen zugrunde lag, die von dem Beschwerdeführer gefilmt wurden.“