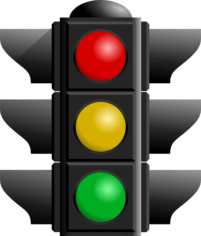Und zum Auftakt der neuen Woche dann zwei Entscheidungen vom BVerfG. Zunächst hier der BVerfG, Beschl. v. 15.02.2023 – 1 BvR 2349/22, der noch einmal zur Frist bei der Verfassungsbeschwerde und zur Wiedereinsetzung Stellung nimmt.
Und zum Auftakt der neuen Woche dann zwei Entscheidungen vom BVerfG. Zunächst hier der BVerfG, Beschl. v. 15.02.2023 – 1 BvR 2349/22, der noch einmal zur Frist bei der Verfassungsbeschwerde und zur Wiedereinsetzung Stellung nimmt.
Die Verfassungsbeschwerde richtet sich gegen eine familiengerichtliche OLG-Entscheidung betreffend einen Versorgungsausgleich. Die dagegen gerichtete Verfassungsbeschwerde hat das BVerfG nicht zur Entscheidung angenommen, weil sie unzulässig ist/war:
„Die Verfassungsbeschwerde wahrt nicht die Frist zur Einlegung und Begründung aus § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG (1). Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 93 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG) ist weder ausdrücklich noch konkludent gestellt. Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand von Amts wegen (§ 93 Abs. 2 Satz 4 BVerfGG) liegen nicht vor (2).
1. Die Beschwerdeführerin hat es versäumt, die Verfassungsbeschwerde innerhalb der Frist aus § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG einzulegen und sie in der durch § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG geforderten Weise zu begründen.
a) Für die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde ist nach § 93 1 Satz 1 BVerfGG erforderlich, dass diese innerhalb eines Monats ab Zustellung der angegriffenen Entscheidung beim Bundesverfassungsgericht eingelegt wird. Hierzu gehört auch die Vorlage aller für die Beurteilung der Verfassungsbeschwerde notwendigen Anlagen, insbesondere der angegriffenen Entscheidungen und aller sonstigen wichtigen Dokumente (vgl. BVerfGE 93, 266 <288>; 129, 269 <278> m.w.N.; BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 4. September 2019 – 1 BvR 1789/19 -, Rn. 3). Ein Nachreichen von Unterlagen nach Ablauf der Monatsfrist ist, vorbehaltlich einer Wiedereinsetzung, grundsätzlich nicht möglich (vgl. BVerfG, Beschlüsse der 1. Kammer des Ersten Senats vom 16. Juni 2017 – 1 BvR 1877/15 -, Rn. 9 und vom 18. Januar 2022 – 1 BvR 2318/21 -, Rn. 6).
b) Dem genügt die Verfassungsbeschwerde nicht. Der angegriffene Beschluss des Oberlandesgerichts wurde der Prozessbevollmächtigten der Beschwerdeführerin eigenen Angaben zufolge am 28. Oktober 2022 zugestellt. Am Tag des Fristablaufs, dem 28. November 2022, ging die per Fax übermittelte Verfassungsbeschwerde jedoch nur in Teilen und ohne darin in Bezug genommene Anlagen ein. So wurden lediglich fünf der elf Seiten umfassenden Verfassungsbeschwerde übersandt sowie die drei zwischen den Eheleuten geschlossenen Eheverträge. Die übrigen sechs Seiten der Verfassungsbeschwerdeschrift und insbesondere der angegriffene Beschluss des Oberlandesgerichts wurden an diesem Tag jedoch nicht mit übersandt. Die Verfassungsbeschwerde gibt dessen wesentlichen Inhalt auch nicht wieder. Erst auf Hinweis des Allgemeinen Registers vom 6. Dezember 2022 folgten am 21. Dezember 2022 die gesamte Begründungsschrift vom 20. Dezember 2022 sowie die der Verfassungsbeschwerde zugrundeliegenden fachgerichtlichen Entscheidungen.
c) Es lässt sich auch nicht zugunsten der Beschwerdeführerin annehmen, dass der vollständige Beschwerdeschriftsatz bis zum Ablauf der Begründungsfrist zusammen mit allen für eine verfassungsrechtliche Prüfung des Beschwerdevorbringens unverzichtbaren Unterlagen tatsächlich in die Verfügungsgewalt des Bundesverfassungsgerichts gelangt ist. Dafür würde zwar ausreichen, dass ein Zugang auf dem Telefaxempfangsgerät des Bundesverfassungsgerichts erfolgt ist (vgl. Hömig, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG, § 93 Rn. 44 m.w.N. <Jan. 2022>).
Von einem vollständigen Zugang der Verfassungsbeschwerde einschließlich der für die Entscheidung darüber erforderlichen Unterlagen kann aber nicht ausgegangen werden. Soweit die Verfahrensbevollmächtigte mit ihrem Schreiben vom 20. Dezember 2022 mit dem Hinweis, Faxübersendungen ihrerseits würden als sogenannte Digi-Faxe erfolgen, bei denen es nicht möglich sei, lediglich Teile zu übersenden, sondern stets der insgesamt eingescannte Schriftsatz als PDF übermittelt werde, einen solchen Zugang behaupten wollte, deckt sich dies nicht mit den feststellbaren tatsächlichen Umständen. So weisen bereits die Begleitschreiben der Faxübermittlungen vom 28. November 2022 ausdrücklich aus, dass die Verfassungsbeschwerde in zwei Teilen sowie die Anlagen gesondert (nämlich einmal Anlagen 1 bis 3 sowie einmal Anlage 7) übersandt werden sollten. Bereits das spricht gegen eine einheitliche und vollständige Übersendung der gesamten Verfassungsbeschwerdeschrift einschließlich sämtlicher dort bezeichneter Anlagen. Zudem weisen drei der per Fax übersandten Begleitschreiben (diejenigen, mit denen die Anlagen 1 bis 3, Anlage 7 sowie der Teil 2 der Verfassungsbeschwerde gesendet wurden) jeweils die Meldung „DISCARDED application/pdf goes here (Attachement too big)“ auf. Das spricht gegen eine vollständige Übersendung und damit gegen einen entsprechenden Zugang bei dem Bundesverfassungsgericht.
2. Eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Einlegung und Begründung der Verfassungsbeschwerde (§ 93 Abs. 2 BVerfGG) kommt nicht in Betracht.
a) aa) Für eine Wiedereinsetzung nach § 93 2 Satz 2 BVerfGG bedarf es eines begründeten Wiedereinsetzungsantrags, in dem das Vorliegen des Wiedereinsetzungsgrundes und die Rechtzeitigkeit des Wiedereinsetzungsantrags substantiiert dargelegt werden. Darüber hinaus muss der Beschwerdeführer die versäumte Rechtshandlung nachholen. Ein ausdrücklicher Wiedereinsetzungsantrag ist nicht erforderlich; es genügt, wenn sich das Wiedereinsetzungsbegehren konkludent aus dem Vortrag des Beschwerdeführers durch Auslegung entnehmen lässt. Dies kann etwa der Fall sein, wenn der Beschwerdeführer in Kenntnis der Fristversäumung bei der Nachholung der Erhebung und/oder Begründung der Verfassungsbeschwerde umfassend auf die Fristversäumung und die eine Wiedereinsetzung rechtfertigenden Umstände eingeht (vgl. Hömig, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, BVerfGG, § 93 Rn. 62 m.w.N. <Jan. 2022>; Peters, in: Barzcak, Mitarbeiterkommentar zum BVerfGG, § 93 Rn. 104 <2018>).bb) Das Schreiben der Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin vom 20. Dezember 2022 enthält weder einen ausdrücklichen Wiedereinsetzungsantrag noch kann es als solcher ausgelegt werden. Es heißt dort:
„Wir bedauern, dass eine vollständige Übermittlung zum Zeitpunkt des Einreichens nicht zustande kam. Diesseits werden Faxe als sogenanntes Digi-Fax übermittelt, d.h. es ist uns nicht möglich, nur Teile zu übersenden, sondern es wird der insgesamt eingescannte Schriftsatz als PDF übermittelt.“
Abgesehen davon, dass diese Erklärung so nicht zutreffen dürfte (dazu Rn. 12), fehlt es an jeglicher Glaubhaftmachung des Wiedereinsetzungsgrundes, nämlich der schuldlosen Fristversäumnis. Dem Schreiben lässt sich nicht einmal entnehmen, dass die Verfahrensbevollmächtigte trotz des zutreffenden Hinweises des Allgemeinen Registers vom 6. Dezembers 2022 auf die Säumnis von einer solchen ausgegangen ist.
b) Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand von Amts wegen nach § 93 2 Satz 4 Halbsatz 2 BVerfGG liegen nicht vor.
aa) Diese ist zu gewähren, wenn außer dem Antrag alle übrigen Voraussetzungen für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vorliegen. Von der Obliegenheit, innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist die für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand relevanten Tatsachen vorzutragen und sie – dies gegebenenfalls auch noch nachträglich nach Ablauf der Frist – glaubhaft zu machen, entbindet § 93 2 Satz 4 Halbsatz 2 BVerfGG nicht. Darüber hinaus kommt eine Wiedereinsetzung von Amts wegen nur in Betracht, wenn die Schuldlosigkeit des Beschwerdeführers an der Nichtwahrung der Monatsfrist jedenfalls überwiegend wahrscheinlich ist (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 6. April 1999 – 2 BvR 299/94 -, Rn. 6).
bb) Diese Voraussetzungen sind nicht gegeben.
(1) Hier fehlt es bereits an einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Nachholung der versäumten Prozesshandlung nach § 93 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 1 BVerfGG binnen der Zwei-Wochen-Frist des § 93 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG. Die am 21. Dezember 2022 auf dem Postweg eingegangene Verfassungsbeschwerde genügt nicht den aus § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG folgenden Anforderungen. Richtet sich eine Verfassungsbeschwerde – wie hier – gegen gerichtliche Entscheidungen, so zählt zu den Anforderungen an die hinreichende Begründung auch die Vorlage der angegriffenen Entscheidungen und derjenigen Schriftstücke, ohne deren Kenntnis die Berechtigung der geltend gemachten Rügen sich nicht beurteilen lässt, zumindest aber deren Wiedergabe ihrem wesentlichen Inhalt nach, da das Bundesverfassungsgericht nur so in die Lage versetzt wird, zu beurteilen, ob die Entscheidungen mit dem Grundgesetz in Einklang stehen (vgl. BVerfGE 112, 304 <314 f.>; 129, 269 <278>). Vorliegend hat es die Beschwerdeführerin versäumt, den Schriftverkehr mit den Fachgerichten und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Oberlandesgericht vorzulegen. Die Kenntnis dieser Unterlagen ist für die verfassungsrechtliche Überprüfung der angegriffenen Entscheidung unerlässlich, weil sich das Oberlandesgericht in seiner Begründung maßgeblich auf die Aussagen der Beschwerdeführerin und ihres früheren Ehemannes in ihren Schriftsätzen und in der Anhörung vom 4. Oktober 2022 stützt. Mangels Vorlage oder hinreichend präziser Wiedergabe der Dokumente lässt sich nicht nachvollziehen, ob die angegriffene Entscheidung des Oberlandesgerichts vom 21. Oktober 2022 den aus Art. 2 Abs. 1 GG sowie aus Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 GG folgenden Anforderungen gerecht wird. Die Möglichkeit einer Verletzung der Beschwerdeführerin in Grundrechten liegt auf der Grundlage der übersandten Unterlagen auch nicht derart auf der Hand (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 10. Dezember 2019 – 1 BvR 2214/19 -, Rn. 13 m.w.N.), dass auf die weiteren Unterlagen verzichtet werden könnte.
(2) Vor allem aber ist es nicht überwiegend wahrscheinlich, dass die Beschwerdeführerin, die sich das Verhalten ihrer Verfahrensbevollmächtigten zurechnen lassen muss (§ 93 Abs. 2 Satz 6 BVerfGG), schuldlos die Einhaltung der Einlegungs- und Begründungsfrist aus § 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG versäumt hat.
(a) Die Verfahrensbevollmächtigte hat aufgrund des ihr erteilten Auftrags, eigenverantwortlich Verfassungsbeschwerde einzulegen, alles ihr Zumutbare zu tun und zu veranlassen, damit die Einlegungsfrist und die sonstigen Anforderungen an die Erhebung der Verfassungsbeschwerde gewahrt werden (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 6. April 1999 – 2 BvR 299/94 -, Rn. 8). Die Bevollmächtigte hat eigenständig die Beschwerdefrist zu ermitteln und dafür zu sorgen, dass die Verfassungsbeschwerde rechtzeitig zur Wahrung der Beschwerdefrist an das Bundesverfassungsgericht übermittelt wird (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 30. Juli 2001 – 2 BvR 128/00 -, Rn. 5). Bei Übermittlung der Verfassungsbeschwerde per Telefax umfassen die Sorgfaltspflichten die Überprüfung der ordnungsgemäßen und vollständigen Versendung des Telefaxes anhand des ausgedruckten Sendeprotokolls des Faxgerätes (vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 30. Mai 2007 – 1 BvR 756/07 -, Rn. 3). Wird eine solche End- und Ausgangskontrolle anhand des Sendeprotokolls unterlassen und damit die fehlerhafte Übertragung übersehen, liegt eine Sorgfaltspflichtverletzung vor, weil die mögliche Wiederholung der Übermittlung vereitelt wird (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 23. Oktober 2008 – 1 BvR 2147/08 -, Rn. 3; Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 21. Oktober 2021 – 1 BvR 838/19 -, Rn. 5).
(b) Diesen Sorgfaltsanforderungen ist die Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin nicht gerecht geworden. Ausweislich der jeweils letzten Seiten der verschiedenen Anschreiben bei der Übermittlung der Verfassungsbeschwerde am 28. November 2022 bekam die Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin dreimal eine Fehlermeldung, dass die vollständige Übersendung gescheitert ist (näher Rn. 12). Auch ergibt sich aus dem Sendungsbericht des Faxgeräts in der Kopfzeile der Dokumente, dass jeweils nur die vier Seiten des Anschreibens versendet wurden. Die Verfahrensbevollmächtigte hätte im Hinblick auf diese Fehlermeldungen bei sorgfaltsgemäßem Verhalten – möglicherweise nach telefonischer Nachfrage, ob tatsächlich und, wenn ja, welche Teile genau fehlen – einen neuen Übermittlungsversuch per Fax starten müssen. Eine solche Ausgangskontrolle hat – obwohl erforderlich – offenbar nicht stattgefunden. Da sich auch aus dem Schreiben vom 20. Dezember 2022 keinerlei Anhaltspunkte ergeben, die auf eine unverschuldete Fristversäumnis schließen ließen, kann vorliegend nicht von einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit eines fehlenden Verschuldens ausgegangen werden.“