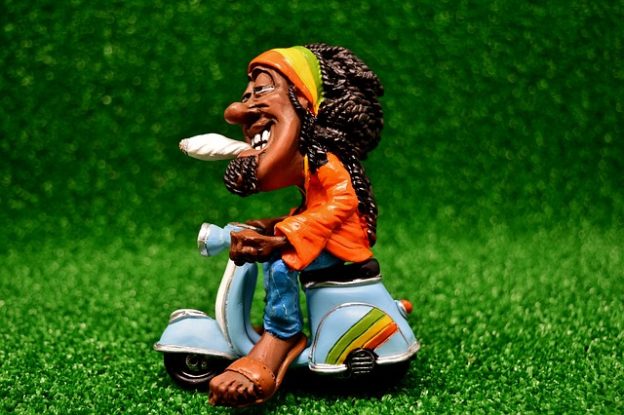Und heute dann im „Kessel Buntes“ zwei Entscheidungen aus dem Verfahrensrecht.
Ich beginne mit einer weiteren Entscheidung zum beA. Die kommt aus einem Verwaltungsverfahren, das in Baden-Württemberg anhängig war.
Nach dem Sachverhalt hatte der Kläger an einer ihm gehörenden Villa Umbauarbeiten vorgenommen, obwohl die Villa im Denkmalbuch stand. Der Kläger hat versucht, die Villa aus dem Denkmalbuch löschen zu lassen. Außerdem hatte er in einem anderen Verfahren beantragt festzustellen, dass die Villa kein Kulturdenkmal darstelle, oder hilfsweise, dass die Umbauarbeiten im Nachhinein genehmigt werden.
Das VG hat beide Klagen am selben Tag abgewiesen. Der Kläger hat dann in beiden Verfahren beantragt, die Berufung zuzulassen. In dem Verfahren betreffend Löschung aus dem Denkmalbuch übersandte sein Prozessbevollmächtigter die Begründung seines Antrags eine halbe Stunde vor Fristablauf. Die Begründung für den zweiten Antrag ging drei Minuten nach Fristablauf beim VGH ein.
Der Kläger hat Wiedereinsetzung beantragt und dazu vorgetragen: Der Kartenleser für den beA-Zugang habe schon am Mittag nicht funktioniert. Deshalb sei ein Gerät eines Kollegen installiert worden, um sich ins beA einloggen zu können. Der Funktionstest auf der zweiten Ebene – Citrix Workspace (eine digitale Arbeitsumgebung) – sei aber negativ ausgefallen. Die Ursache dafür habe wohl in dem Server gelegen, der außerhalb der Kanzlei arbeitete. Er habe deshalb den Schriftsatz erstellen, dann in der Cloud abspeichern und dann über beA versenden wollen. Diese „Synchronisation“ dauere an sich nur wenige Sekunden. Im Verfahren „Denkmalbuch“ habe das auch geklappt. Dann habe er sich den Wecker auf fünf vor Mitternacht gestellt, um bis dahin noch an dem Schriftsatz zu arbeiten. Als es dann zur Versendung gekommen sei, habe die Synchronisation wesentlich länger als erwartet gedauert.
Der VGH Baden-Württemberg hat den Antrag mit dem VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 14.12.2023 – 1 S 1173/23 – zurückgewiesen:
„2. Der Antrag des Klägers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 60 Abs. 1 VwGO ist abzulehnen, weil sein Prozessbevollmächtigter nicht ohne Verschulden verhindert war, die gesetzliche Frist des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO, einzuhalten.
a) Verschuldet i.S.v. § 60 Abs. 1 VwGO ist eine Fristversäumnis, wenn der Beteiligte die Sorgfalt außer Acht gelassen hat, die für einen gewissenhaften und seine Rechte und Pflichten sachgemäß wahrnehmenden Prozessführenden geboten ist und die ihm nach den gesamten Umständen des konkreten Falles zuzumuten ist (vgl. BVerwG, Beschl. v. 23.02 2021 – 2 C 11/19 – juris Rn. 6, m.w.N.). Dabei ist ihm ein Verschulden seines Prozessbevollmächtigten zuzurechnen (§ 173 VwGO i. V. m. § 85 Abs. 2 ZPO). Die „Beweislast“ für die Umstände, die dafür sprechen, dass die Fristversäumnis unverschuldet war, liegt bei dem Betroffenen, der die Wiedereinsetzung begehrt (vgl. BVerwG, Beschl. v. 25.05.2010 – 7 B 18/10 – juris Rn. 4, m.w.N.). Gelingt die Glaubhaftmachung nicht oder bleibt nach den glaubhaft gemachten Tatsachen zumindest die Möglichkeit offen, dass die Fristversäumung von dem Beteiligten bzw. seinem Prozessbevollmächtigten verschuldet war, so kann Wiedereinsetzung nicht gewährt werden (BVerwG, Beschl. v. 25.09.2023 – 1 C 10/23 – juris Rn. 12; BGH, Beschl. v. 01.03.2023 – XII ZB 228/22 – juris Rn. 13).
Prozessuale Fristen – wie des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO – dürfen bis zu ihrer Grenze ausgenutzt werden (st. Rspr., vgl. BVerfG, Kammerbeschl. v. 14.02.2023 – 2 BvR 653/20 – juris Rn. 22, m.w.N.; Beschl. v. 15.01.2014 – 1 BvR 1656/09 – juris Rn. 37; BVerwG, Beschl. v. 25.09.2023, a.a.O. Rn. 15, m.w.N.). Einem Verfahrensbeteiligten kann daher nicht vorgeworfen werden, dass er bis zum letzten Tag der Frist abwartet, ehe er eine fristgebundene prozessrechtliche Erklärung abgibt. Wird eine Rechtsmittelfrist oder die Begründungsfrist bis zum letzten Tag ausgeschöpft, so treffen den Verfahrensbeteiligten allerdings erhöhte Sorgfaltspflichten. Er muss alle gebotenen und zumutbaren Maßnahmen treffen, um die Gefahr einer Fristversäumnis zu vermeiden. Ein pflichtbewusster Rechtsanwalt ist daher kurz vor Ablauf der Berufungsbegründungsfrist verpflichtet, jedes Risiko zu meiden, das zu einer Fristversäumung führen oder beitragen kann (BVerfG, Kammerbeschl. v. 02.07.2014 – 1 BvR 862/13 – juris Rn. 4, m.w.N.; BVerwG, Beschl. v. 25.05.2010, a.a.O.Rn. 6, m.w.N.; BGH, Beschl. v. 09.05.2006 – XI ZB 45/04 – juris Rn. 8 ff.).
Eine Fehlfunktion technischer Einrichtungen in der Anwaltskanzlei entlastet den Rechtsanwalt (nur) dann, wenn die Störung plötzlich und unerwartet aufgetreten ist und durch regelmäßige Wartung der Geräte nicht hätte verhindert werden können (BGH, Beschl. v. 18.02.2020 – XI ZB 8/19 – juris Rn. 12; Beschl. v. 15.12.2022 – I ZB 35/22 – juris Rn. 13). Dabei ist ein Rechtsanwalt bei Ausschöpfung einer Frist bis zum letzten Tag zwar nicht verpflichtet, die technischen Systeme stets vorsorglich auf dessen Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Er missachtet aber dann die gebotene Sorgfalt, wenn er wegen eines Versagens des technischen Systems konkreten Anlass dafür hat, an dessen verlässlicher Funktionstauglichkeit zu zweifeln (BGH, Beschl. v. 16.11.2016 – VII ZB 35/14 – juris Rn. 13; Beschl. v. 18.02.2020, a.a.O. Rn. 12; je zum Telefax).
Bei der Übersendung von Schriftsätzen mittels Telefax muss der Versender Verzögerungen berücksichtigen, mit denen üblicherweise zu rechnen ist, wozu schwankende Übertragungsgeschwindigkeiten oder die Belegung des Telefax-empfangsgeräts bei Gericht durch andere eingehende Sendungen gehören, und daher einen über die zu erwartende Übermittlungsdauer der zu faxenden Schriftsätze samt Anlagen hinausgehenden Sicherheitszuschlag in der Größenordnung von 20 Minuten einkalkulieren (st. Rspr., BVerwG, Beschl. v. 25.09.2023, a.a.O. Rn. 17, m.w.N.).
Auch im elektronischen Rechtsverkehr muss mit einer nicht jederzeit reibungslosen Übermittlung gerechnet werden, und können z.B. Schwankungen bei der Internetverbindung oder eine hohe Belastung des Servers kurz vor Mitternacht etwa wegen einer großen Anzahl eingehender Nachrichten oder wegen der Durchführung von Software-Updates zu Verzögerungen führen, die einzukalkulieren sind (BVerwG, Beschl. v. 25.09.2023, a.a.O. Rn. 18; HessVGH, Beschl. v. 24.08.2022 – 4 A 149/22.Z – juris Rn. 10; OLG Frankfurt, Beschl. v. 03.11.2021 – 6 U 131/21 – juris Rn. 14). Dem ist durch eine zeitliche Sicherheitsreserve bei der Übermittlung fristgebundener Schriftsätze Rechnung zu tragen (BVerwG, Beschl. v. 25.09.2023, a.a.O. Rn. 18f.).
b) Nach diesem Maßstab ist die Versäumung der Begründungsfrist nach § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO hier verschuldet. Ein Verschulden liegt in mehrfacher Hinsicht vor. Jeder dieser Sorgfaltsverstöße führt bereits je für sich zur Ablehnung der Wiedereinsetzung nach § 60 Abs. 1 VwGO.
aa) Auch im elektronischen Rechtsverkehr muss, wie ausgeführt, durch einen pflichtgemäß handelnden Rechtsanwalt eine zeitliche Sicherheitsreserve bei der Übermittlung fristgebundener Schriftsätze einkalkuliert werden. Dabei ist eine Zeitspanne von unter sieben Minuten für die Übermittlung über das besondere elektronische Anwaltspostfach bei einer nur ca. 280 KB umfassenden Datei zu knapp bemessen (BVerwG, Beschl. v. 25.09.2023, a.a.O. Rn. 18f.). Zu knapp kalkuliert ist daher auch – wie hier – eine Zeitspanne von weniger als fünf Minuten für eine Datei von ca. 300 KB. Das Vorsehen eines so kurzen Zeitraums für die Übermittlung ist auch angesichts des vom Prozessbevollmächtigten geltend gemachten Vertrauens auf eine vergleichbar schnelle Versendung wie im Verfahren 1 S 1126/23 ein Verschulden i.S.v. § 60 Abs. 1 VwGO. Maßgeblich ist auch bei Erfahrungswerten eines Prozessbevollmächtigten die unter normalen Umständen zu erwartende Übermittlungsdauer zuzüglich eines Sicherheitszuschlags (BGH, Beschl. v. 27.09.2018 – IX ZB 67/17 – juris Rn. 20, 21). Zudem beruft sich der Prozessbevollmächtigte hier nur auf den „Erfahrungswert“ aus einem einzigen anderen Verfahren.
Liegt mithin bereits mangels Einkalkulierens einer ausreichenden zeitlichen Sicherheitsreserve eine Sorgfaltspflichtverletzung vor, so kommt es nicht auf die Frage an, ob eine – wie hier geltend gemacht – unvorhersehbare und unvermeidbare Störung der Hard- oder Software des Computersystems in der Anwaltskanzlei vorlag (BVerwG, Beschl. v. 25.09.2023, a.a.O. Rn. 22).
bb) Ein Verschulden i.S.v. § 60 Abs. 1 VwGO ist es auch, die für das Erstellen des fristgebundenen Schriftsatzes notwendige Synchronisation zwischen dem lokalen PC des Anwalts und einem Arbeitssystem auf einem Server in einem weit entfernten Rechenzentrum erst fünf Minuten vor dem Fristende durchzuführen. Diese Synchronisation ist auf Leitungen außerhalb der Kanzlei und die Übermittlung über Internetverbindungen angewiesen. Daher müssen bei sorgfältigem Handeln – wie bei der Übermittlung von Schriftsätzen an das Gericht per Telefax oder im elektronischen Rechtsverkehr – ausreichende Zeitreserven eingeplant werden. Dies hat der Prozessbevollmächtigte des Klägers hier pflichtwidrig unterlassen.
Der Umstand, dass diese Synchronisation im Verfahren 1 S 1126/23 um 23:28 Uhr innerhalb weniger Sekunden funktionierte und der IT-Mitarbeiter xxx dem Prozessbevollmächtigten mitgeteilt hatte, dass eine in der zweiten Ebene in OneDrive gespeicherte Datei mit der hier zu erwartenden Größe von ca. 300 KB in aller Regel sofort synchronisiert werde, d.h. innerhalb weniger Sekunden (maximal binnen einer Minute) auf der ersten Ebene zur Verfügung stehe, entlastet den Prozessbevollmächtigten nicht. Denn zwischen dem Kanzleistandort mit lokalen PCs und einem Server in einem weit entfernten, externen Rechenzentrum ist mit Übertragungsproblemen und schwankenden Internetverbindungen zu rechnen. Dieses Risiko hat der pflichtbewusste Rechtsanwalt kurz vor Fristende zu meiden.
cc) Ein weiteres Verschulden i.S.v. § 60 Abs. 1 VwGO liegt darin, dass der Prozessbevollmächtigte am 14.08.2023 für die Erstellung des Schriftsatzes mit der Begründung des Antrags auf Zulassung der Berufung keinen anderen sichereren Weg wählte, als am Nachmittag nicht aufzuklärende technische Probleme auf der zweiten Ebene des Computersystems auftraten. Beim Funktionstest mit dem externen IT-Mitarbeiter xxx am Tag des Fristablaufs zwischen 15 und 16 Uhr fiel der Funktionstest auf der zweiten Ebene negativ aus und wurde die Karte auf der zweiten Ebene im beA-Portal nicht erkannt, während der Kartenleser auf der ersten Ebene, auf dem lokalen PC funktionierte. Der IT-Mitarbeiter xxx konnte selbst nicht nachvollziehen, warum das Kartenlesegerät nur auf der ersten, nicht aber auf der zweiten Ebene funktionierte. Das Computersystem der Kanzlei funktionierte auf der zweiten Ebene mithin nicht störungsfrei. Wenn solche Störungen auftreten, erhöhen sich die Sorgfaltspflichten des Rechtsanwalts und ist er verpflichtet, parallele Sicherungsmaßnahmen durchzuführen (BGH, Beschl. v. 27.01.2015 – II ZB 21/13 – juris Rn. 10 ff., zu Sicherungsmaßnahmen bei eingeschränktem Zugriff auf den Fristenkalender auf einem externen Server). Zu einer solchen Sicherungsmaßnahme hätte hier gehören können, den fristgebundenen Schriftsatz ausschließlich auf dem lokalen PC zu erstellen. Dies hat der Prozessbevollmächtigte pflichtwidrig unterlassen.“