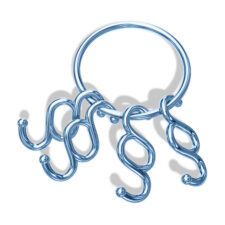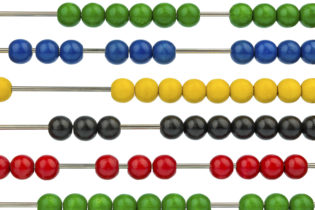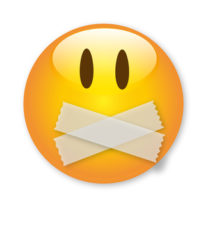Hier hatte der Angeklagte sein Rechtsmittel in der Berufungshauptverhandlung auf den Rechtsfolgenausspruch und diesen weiter auf die Frage der Vollstreckung der gegen ihn verhängten Freiheitsstrafe zur Bewährung beschränkt. Das hat beim OLG „gehalten“. Das OLg führt dazu (noch einmal) aus:
„b) Gegenstand der revisionsgerichtlichen Überprüfung ist allein die Entscheidung des Landgerichts, die Vollstreckung der erkannten Gesamtfreiheitsstrafe nicht zur Bewährung auszusetzen. Die seitens des Angeklagten schon im Berufungsverfahren erklärte Beschränkung des Rechtsmittels auf die Frage der Strafaussetzung zur Bewährung ist auch im Revisionsverfahren nicht nur formell (§§ 302 Abs. 2, 303 StPO), sondern auch materiell wirksam. Die Beschränkung des Rechtsmittels auf bestimmte Beschwerdepunkte (vgl. für die Berufung: § 318 Abs. 1 StPO; für die Revision: § 344 Abs. 1 StPO „inwieweit“) ist nach der so genannten Trennbarkeitsformel insoweit wirksam, als sie dem Rechtsmittelgericht die Möglichkeit eröffnet, den angefochtenen Teil des Urteils losgelöst vom nicht angegriffenen Teil der Entscheidung nach dem inneren Zusammenhang rechtlich und tatsächlich zu beurteilen, ohne die Prüfung des übrigen Urteilsinhalts notwendig zu machen. Die den Rechtsmittelberechtigten eingeräumte „Macht zum unmittelbaren Eingriff in die Gestaltung des Rechtsmittels“ (RGSt 69, 110, 111; vgl. auch BGHSt 14, 30, 36) gebietet es, den in Rechtsmittelerklärungen zum Ausdruck gekommenen Gestaltungswillen im Rahmen des rechtlich Möglichen zu respektieren. Das Rechtsmittelgericht kann und darf diejenigen Entscheidungsteile nicht nachprüfen, deren Nachprüfung von keiner Seite begehrt wird, wenn und soweit der angegriffene Entscheidungsteil trennbar ist, also losgelöst vom übrigen Urteilsgehalt selbständig geprüft und beurteilt werden kann (siehe schon: RGSt 65, 296; RGSt 69, 110, 111; ebenso: BGHSt 19, 46, 48; BGHSt 24, 185, 187; BGH NJW 1981, 589, 590, jeweils m.w.N.).
Die Entscheidung über die Strafaussetzung zur Bewährung ist ein selbständiger Teil des Urteilsspruchs (§ 260 Abs. 4 S. 4 StPO). Sie kann isoliert angefochten werden, wenn sich die ihr zugrunde liegenden Erwägungen von denen der Strafzumessung trennen lassen (BGH NStZ 1994, 449; KG, Urteil vom 13. Dezember 2006, (5) 1 Ss 305/06 (49/06) m. w. N., Juris; OLG Dresden NStZ-RR 2012, 289; OLG Hamburg NStZ-RR 2006, 18, StraFo 2016, 518; Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 65. Auflage, zu § 318, Rz. 20a m. w. N.). An der Trennbarkeit fehlt es nicht schon dann, wenn sich die bei der Strafzumessung und bei der Aussetzungsentscheidung zu berücksichtigenden Tatsachen überschneiden (KG a.a.O.; OLG Frankfurt VRS 59, 106, 108). Insoweit doppelt relevante Feststellungen verknüpfen diese Entscheidungen regelmäßig miteinander; vom Gesetzgeber ist in § 46 Abs. 2 StGB und § 56 Abs. 1 S. 2 StGB vorgesehen, dass diejenigen Tatsachen, welche die Zumessung der Strafe im engeren Sinn mitbestimmen, auch für die Aussetzungsentscheidung wesentliche Bedeutung erlangen könnten (KG a.a.O. und m.w.N.).
Die Beschränkung der Revision auf die Aussetzungsentscheidung ist indes nur dann unwirksam, wenn die Tatsachenfeststellungen und Erwägungen zum Strafmaß so unzulänglich sind, dass sie keine hinreichende Grundlage für die Aussetzungsentscheidung bilden (KG a.a.O.; OLG Köln NStZ 1989, 90, 91; VRS 61, 365, 567; OLG Frankfurt VRS 59, 106, 107), die Entscheidung über die Bewährung an einem Fehler leidet, der zugleich die Strafzumessung betrifft (KG a.a.O.; OLG Frankfurt a.a.O., S. 110; OLG Köln VRS 61, 365, 367), der Anfechtende sich gegen die Feststellung oder Nichtfeststellung einer doppeltrelevanten Tatsache wendet (BGH NJW 2001, 3134; OLG Frankfurt NStZ-RR 1996, 309; KG a.a.O.) oder eine unzulässige Verknüpfung von Strafmaß- und Aussetzungsentscheidung hergestellt worden ist (BGH NStZ 2001, 311; OLG Frankfurt VRS 59, 106, 109; OLG Köln VRS 61, 365, 367; KG a. a. O.). Stets muss gewährleistet sein, dass das stufenweise entstehende Urteil frei von inneren Widersprüchen bleibt (BGHSt 29, 359, 365; NJW 2001, 3134; NStZ-RR 1999, 359; OLG Frankfurt NStZ-RR 1996, 309, 310; KG a.a.O.).
Hieran gemessen, erweist sich die Beschränkung der Berufung auf die Frage der Strafaussetzung als wirksam. Das Landgericht hat die Strafzumessung getrennt von der Strafaussetzung begründet und auch inhaltlich nicht unzulässig miteinander verknüpft. Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Kammer wegen der Versagung der Strafaussetzung auf höhere oder niedrigere Einzelstrafen oder eine hieran angepasste Gesamtfreiheitsstrafe erkannt hätte. Die Tatsachenfeststellungen und Erwägungen zur Strafzumessung bilden – auch – eine ausreichende Grundlage für die Entscheidung über die Strafaussetzung zur Bewährung. Die Revision rügt ausschließlich Rechtsfehler bei der Anwendung des § 56 StGB, die das Strafmaß nicht berühren.“
Wegen der Ausführungen des OLG zur Sache dann bitte im verlinkten Volltext nachlesen.