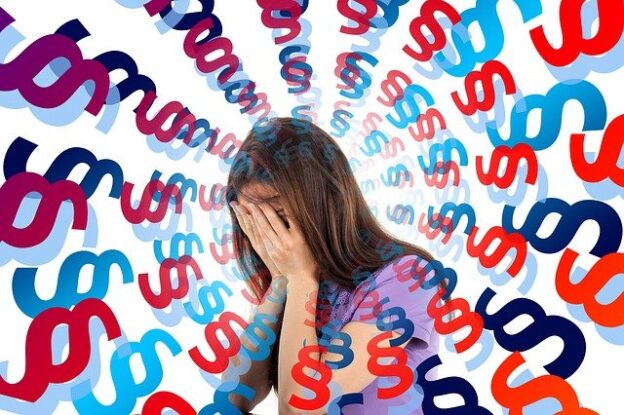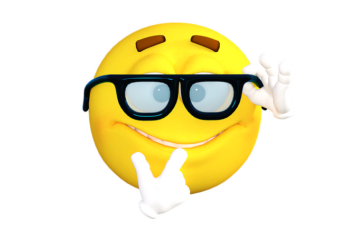
Bild von Pete Linforth auf Pixabay
Den Reigen von Bewährungsentscheidungen, die ich heute vorstelle, eröffne ich mit dem OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 09.10.2023 – 7 Ws 155/23. Es geht um den Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung gemäß § 56f Abs. 1 Nr. 1 StGB nach einer Exequaturentscheidung.
Folgender Sachverhalt:
„Das Amtsgericht in Stadt1/Kroatien (Az. Kov-111/2020-22) hat den Beschwerdeführer mit Urteil vom 29. April 2020, rechtskräftig seit dem 16. Juli 2020, wegen „Beihilfe zur unerlaubten Drogenproduktion und zum unerlaubten Drogenverkehr“ verurteilt, weil er im November 2019 am Anbau von Cannabis beteiligt war. Das Gericht hat auf eine Freiheitsstrafe von elf Monate erkannt, die durch „Arbeit für gemeinnützige Zwecke“ ersetzt wurde, wobei „ein in der Haft verbrachter Tag mit zwei Stunden Arbeit ersetzt“ wurde, was nach dem Urteilsspruch 660 Stunden abzuleistende Arbeit entspricht. Ferner hat das Gericht bestimmt, dass diese Arbeit nach der Zustimmung des Beschwerdeführers vor der Probationskommission für gemeinnützige Zwecke in einer von der Kommission festgelegten Frist, die nicht kürzer als einen Monat und nicht länger als zwei Jahre betragen darf, zu erbringen ist. Für den Fall, dass der Beschwerdeführer die Arbeit für gemeinnützige Zwecke durch eigene Schuld ganz oder teilweise nicht erbringt, ist schließlich bestimmt, dass das Gericht die Vollstreckung der ausgesprochenen Strafe in Ganzheit oder teilweise anordnen wird.
Die kroatischen Behörden haben die deutschen Behörden unter Vorlage des Urteils und Beifügung einer „Bestätigung aus Anhang I, Rahmenbeschluss 2008/947 / JI des Europarats vom 27. November 2008 für die Anerkennung von Bewährungsentscheidungen“ um die Anerkennung der Bewährungsentscheidung des vorgenannten Urteils ersucht. In dieser Bestätigung ist unter Ziff. 5) ausgeführt, dass der Beschwerdeführer während des Verfahrens fünf Monate in Untersuchungshaft verbracht habe, was bedeute, dass er noch sechs Monate Haft verbüßen und dementsprechend noch 360 Stunden für das Gemeinwohl arbeiten müsse.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat mit Datum vom 27. September 2021 das Vorliegen von Bewilligungshindernissen gemäß § 90c IRG verneint und am selben Tag Antrag auf gerichtliche Entscheidung gemäß §§ 90g Abs. 1, 90h Abs. 1 IRG gestellt.
Auf den Antrag auf gerichtliche Entscheidung der Staatsanwaltsanwaltschaft Frankfurt am Main vom 27. September 2021 traf das Landgericht Frankfurt am Main – Strafvollstreckungskammer – nach Anhörung des Beschwerdeführers mit Datum vom 15. Dezember 2021 die Exequaturentscheidung. Der Ausspruch lautete dahin, dass die Freiheitsstrafe von elf Monaten aus dem Urteil des Amtsgerichts Stadt1 vom 29. April 2020, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde, vollstreckbar ist. Zudem wurde bestimmt, dass Teile der Sanktion, die in Kroatien bereits vollstreckt worden sind, anrechenbar seien. Es wurde eine Bewährungszeit von zwei Jahren festgesetzt, innerhalb welcher der Beschwerdeführer 660 Stunden gemeinnützige Arbeit nach näherer Weisung des für die Überwachung der Bewährung zuständigen Gerichts abzuleisten habe. Der Beschluss der Strafvollstreckungskammer ist seit dem 30. Dezember 2021 rechtskräftig.
Der Beschwerdeführer wurde mit Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 13. Mai 2022 [Az. 5/26 KLs 5702 Js 230083/21 (3/22)] wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt. Das Urteil gegen den in der Hauptverhandlung vor dem Landgericht Frankfurt am Main geständigen Angeklagten ist seit dem 8. Februar 2023 rechtskräftig.
Aufgrund dieser erneuten Verurteilung des Beschwerdeführers hat die Strafvollstreckungskammer mit Beschluss vom 12. Juni 2023 die mit der Exequaturentscheidung gewährte Strafaussetzung zur Bewährung gemäß § 56f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 StGB widerrufen. Dabei stellte die Strafvollstreckungskammer – im Anschluss an die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 22. November 2022 (Az. 2 Ws 57/22) – darauf ab, dass die Bewährungszeit – obschon die Exequaturentscheidung nach der Begehung der erneuten Tat ergangen ist – bereits mit der Rechtskraft des Urteils des Amtsgerichts Stadt1, also seit dem 16. Juli 2020, zu laufen begonnen habe und die Tatbegehung damit innerhalb der Bewährungszeit liege.
Gegen diesen, der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am 16. Juni 2023 zugestellten Beschluss, richtet sich deren sofortige Beschwerde, die beim Landgericht Frankfurt am 19. Juni 2023 einging.
Zur Begründung führt die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main in der Beschwerdeschrift aus, dass im vorliegenden Verfahren lediglich die Überwachung der Bewährungszeit, jedoch nicht die Vollstreckung der Strafe aus dem kroatischen Urteil übernommen worden sei. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main folgt der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main im Ergebnis und beantragt, den angegriffenen Beschluss aufzuheben. Insofern führt die Generalstaatsanwaltschaft aus, dass die Exequaturentscheidung vom 15. Dezember 2021 inhaltlich zwar unzutreffend gewesen sei, der Beschluss aber in Rechtskraft erwachsen sei. Allerdings sei die Strafvollstreckungskammer, unabhängig davon, ob die Überwachung der alternativen Sanktionen oder fälschlich die Überwachung einer tatsächlich nicht verhängten Strafaussetzung zur Bewährung für vollstreckbar erklärt worden sei, jedenfalls nicht befugt gewesen, in eigener Zuständigkeit eine Widerrufsentscheidung zu treffen. Gemäß § 90k Abs. 1 IRG wäre nämlich allenfalls die Überwachung der vermeintlichen Bewährungsmaßnahme (oder alternativen Sanktion) übernommen worden, nicht aber eine Bewährungsstrafe als solche. Demgemäß obliege dem überwachenden Gericht nicht die Entscheidung über das Schicksal der Strafaussetzung zur Bewährung. Nach § 90k Abs. 3 Nr. 3 IRG habe das Gericht, wenn es im Rahmen der Überwachung selbst einen Grund zum Widerruf sieht, von der weiteren Überwachung abzusehen und gemäß § 90k Abs. 4 S. 1 Nr. 1, S. 2 IRG den Urteilsstaat zu unterrichten.“
Und das Rechtsmittel hat beim OLG Erfolg. Das sagt:
Wurde eine bedingte Freiheitsstrafe im Rahmen einer rechtskräftigen Exequaturentscheidung für vollstreckbar erklärt, obschon eine solche nach dem ausländischen Urteil tatsächlich nicht verhängt worden war, kommt ein Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung jedenfalls dann nicht gemäß § 56f Abs. 1 Nr. 1 StGB in Betracht, wenn der Verurteilte die neue Straftat vor der Exequaturentscheidung begangen hat.