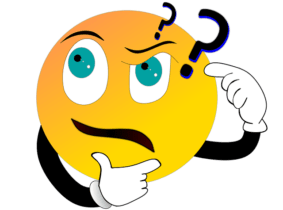Der Anzeigeerstatter hat sich mit einer Strafanzeige gegen Äußerungen des Angeschuldigten gewendet, der unter einem Alias als Rapper auftritt. Dem Angeschuldigten wird in der dann erhobenen Anklage vorgeworfen, er habe den Anzeigeerstatter in einem Facebook-Post vom 13.02.2019 als „Botoxfresse‘ beleidigt; ferner habe der aa Angeschuldigte ein Video mit einem Disstrack über den Anzeigeerstatter veröffentlicht, wobei weitere Angeschuldigte als Komparsen oder Produzenten mitgewirkt haben sollen.
Das AG hat die Eröffnung des Hauaptverfahrens abgelehnt und das recht umfangreich begründet. Um zu verstehen, worum es geht – vor allem wegen der Hintergründe – muss man die Beschlussgründe ziemlich umfassen einestellen:
„… Bei dem Anzeigeerstatter handelt es sich um eine freiwillig in der Öffentlichkeit stehende Person. Als Person der Zeitgeschichte ist er Hauptdarsteller in einer Reality-Show, in der er sich und seine Familie als sehr reiche Personen vorstellt, die dem internationalen Jetset angehören und ein Leben im Luxus führen. In diesem Rahmen stellt sich der Anzeigeerstatter in die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit. Dabei äußert er selbst mitunter polarisierende Meinungen, die von Teilen der Zuschauer als polemisch oder unangemessen aufgefasst werden und teilweise heftige Reaktionen hervorrufen.
In diesem Zusammenhang hat der Anzeigeerstatter als Person des öffentlichen Lebens ein Video von sich veröffentlichen lassen, in dem er sich vor der Scheich-Zayid- Moschee in Abu Dhabi befindet. Diese Moschee stellt eine der größten und bedeutsamsten Moscheen weltweit und eine wichtige religiöse Örtlichkeit für Muslime dar. In diesem Video äußert der Anzeigeerstatter, dass er nun schon seit langer Zeit auf der Suche nach einer Immobilie in Dubai für seine Familie und nunmehr fündig geworden sei, wobei er auf die Moschee deutet. Weiter heißt es in dem Video, dass auch für Livemusik gesorgt sei. Insoweit spielt der Anzeigeerstatter in dem Videobeitrag auf den Ruf des Muezzins an.
Insoweit hat der Anzeigeerstatter einen von vielen Zuschauern als provozierend aufgenommenen Beitrag in Bezug auf die Ausübung und den Stellenwert der islamischen Religion in die sozialen Medien eingestellt, als er das Video verbreitete.
Es kam im weiteren zu verschiedenen Gegenäußerungen und Kritik an dem Anzeigeerstatter für die Darstellung in dem von ihm geposteten Video. Der Anzeigeerstatter reagierte darauf, in dem er das Video über die Moschee als -missglückten – Witz darstellte.
In diesem Zusammenhang sind die Äußerungen, die Gegenstand des Strafverfahrens sind, als Antwort auf das Video des Anzeigeerstatters einzuordnen. Der Angeschuldigte pp. erstellte dabei einen Disstrack, in dem er sich mit den Äußerungen des Anzeigerstatters über die Moschee befasst.
Nach dem Anklagevorwurf wurde das Disstrack-Video im März 2019 auf dem Internet-Videoportal YouTube auf Veranlassung des Angeschuldigten zu 1. (alias pp) veröffentlicht, jedoch nach ganz kurzer Zeit wieder von dem Youtube-Kanal des Angeschuldigten gelöscht. Zuvor ist es weiter verbreitet worden und lässt sich weiterhin auf Youtube, allerdings unter dem Kanal eines Anhängers des Anzeigerstatters („pp.9, abrufen.
Auf dem besagten Musikvideo ist im Wege der filmischen Darstellung zu sehen, wie zwei Laiendarsteller, die offensichtlich den Anzeigeerstatter nebst Gattin darstellen sollen, in einem Auto fahren. Die Darstellung erfolgt dabei in überspitzter und satirischer Form und macht sich über das in dem TV-Format des Anzeigerstatters gezeigte Verhalten („zum Friseur gehen, shoppen, eine Yacht kaufen…“) lustig. Im weiteren Verlauf des Musikvideos wird sodann durch Laiendarsteller eine Entführung des Anzeigeerstatters und seiner Frau dargestellt, wobei die Charaktere mit einem Auto in eine Werkstatt verbracht werden. Insgesamt wirkt die Sequenz satirisch überspitzt und comedyhaft bis lächerlich. Anschließend wird das Video des Anzeigeerstatters über die Moschee in Abu Dhabi eingespielt. Sodann startet der eigentliche Musikbeitrag/der Rap, den der Angeschuldigte zu 1. Vorträgt. Darin heißt es unter anderem:
„R. für eine Botoxfresse“
Sodann zielt eine Person mit einem Gegenstand, der wie ein Gewehr aussieht auf den Schauspieler, der den Anzeigeerstatter darstellt und dazu wird gerappt:
„ Geh in Deckung, Mann. Ich lade jetzt mein Eisen auf dich gezielt, pp.. Weiter heißt es, „ ein Hund wie du sei leise , sonst nehme ich dich als Geisel“ . Ferner wird der offenbar den Anzeigeerstatter darstellende Mann als „Schwein“ und „Hurensohn“ bezeichnet und es heißt dann:. „Ich gehöre zu den Miesen, wenn es sein muss, werde ich schießen“.
Tatsächliche Körperverletzungen sind filmisch nicht dargestellt.
Das Video endet damit, dass der Angeschuldigte zu 1. dem Darsteller, der offenbar den Anzeigeerstatter verkörpern soll, durchs Haar fährt und dabei- äußert: „du Spaßvogel, denk nächstes Mal nach, bevor du solche Witze machst.“
Die weiteren Angeschuldigten sollen Komparsen in dem Video mit dem Disstrack bzw. der Produzent des Videos sein.
Der Anzeigeerstatter hat über seine Rechtsanwälte Strafanzeige unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung gestellt.
II.
Bei rechtlicher Bewertung dieser Gesamtsituation kann eine Strafbarkeit der Angeschuldigten nicht mit der für die Eröffnung des Hauptverfahrens zu fordernden Wahrscheinlichkeit aus tatsächlichen sowie rechtlichen Gründen festgestellt werden.
…..
2. Auch in rechtlicher Hinsicht begegnet die Anklage durchgreifenden Bedenken:
a) Beleidigung durch den Disstrack seitens des Angeschuldigten zu 1.
In dem besagten Disstrack, also dem Rap des Angeschuldigten zu 1., wird der die Person des Anzeigerstatters darstellende Schauspieler unter anderem als „Hund“, „Schwein“ und „Hurensohn“ tituliert.
Dies sind eindeutig ehrverletzende Äußerungen.
Diese Äußerungen erfolgten nicht im persönlichen Kontakt oder direkter Ansprache über Kommunikationsmittel, sondern im Rahmen einer fiktiven Darstellung. Es wird eine filmische Episode erzählt, die den Anzeigeerstatter persifliert.
Hinzu kommt, dass die Äußerungen im Rahmen eines gereimten Raps aus dem Genre Gangsterrap erfolgten. In diesem Genre ist die Besonderheit der Darstellung darin begründet, dass kriminalitäts- und gewaltverherrlichende Darstellungen mit einer vulgären Wortwahl erfolgen.
Dabei ist anerkannt, dass der Gangsterrap eine eigene Kunstform darstellt, die ebenso wie Satire und Persiflage unter dem Schutzbereich der grundgesetzlichen Kunstfreiheit stehen, auch wenn darin – wie es dem Wesen dieser Rapform entspricht – gewaltverherrlichende oder beleidigende Äußerungen enthalten sind.
Die Kunstfreiheit findet ihre Grenzen dort, wo das schützwürdige Persönlichkeitsrecht des Einzelnen betroffen ist. Dabei ist eine Abwägung vorzunehmen zwischen den Persönlichkeitsrechten des Adressaten und der Kunstfreiheit (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19.01.20, III- 4 RvS 193109 IV). Die Grenze der strafbaren Beleidigung ist in diesem Kontext erst dann erreicht, wenn die persönliche Kränkung den Schwerpunkt des Beitrags darstellt im Sinne einer Schmähkritik. Das ist in dem Kontext dann der Fall, wenn die Ehrverletzung die sachliche Auseinandersetzung vollends und beabsichtigt in den Hintergrund drängt (BVerfG, Beschluss vom 17.09.12, Az. 1 BvR 2979/10).
Hier verhält es sich so, dass eine in vertonter Reimform verfasste künstlerische Auseinandersetzung mit dem zuvor vom Anzeigeerstatter veröffentlichten Video über die Moschee als Wohnimmobilie dargestellt wird. Das wird deutlich an dem eingespielten Video des Anzeigerstatters und an den im Rap enthaltenen Äußerungen wie „ sag nicht zur Moschee Immobilie“ , „provozier nochmal den Islam“, „du Spaßvogel, denk nächstes Mal nach, bevor du solche Witze machst“.
Insoweit ist bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen, dass der Anzeigeerstatter selbst anlasslos eine von der muslimischen Community als provozierend und als respektlos empfundene Äußerung über religiöse Inhalte gegenüber einem breiten Publikum abgab. Der Anzeigeerstatter hat diese Äußerung selbst in den sozialen Medien publik gemacht und hatte somit durchaus mit Gegenäußerungen, auch in unsachlicher Form, zu rechnen.
Der hier zu beurteilende Disstrack stellt eine solche Gegenäußerung mit künstlerischen Mitteln dar.
Die Grenze der Kunstfreiheit in diesem Kontext wäre erst erreicht, wenn bei einer Äußerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache im Vordergrund steht, sondern die Herabsetzung einer Person im Sinne einer Schmähkritik.
Dies ist hier nicht der Fall. Denn es ging angesichts der Verlinkung mit dem Beitrag über die Moschee als Wohnimmobilie um eine Auseinandersetzung mit Sachbezug, die nicht schwerpunktmäßig auf das persönliche Diffamieren des Anzeigeerstatters ausgelegt ist. Vielmehr ist der Einsatz der typischen sprachlichen Stilmittel des Gangsterraps gerade erfolgt, um mit der Art der Darstellung eine besondere Aufmerksamkeit in der Auseinandersetzung um das Sachthema zu erregen.
Es ist nicht ersichtlich, dass der Angeschuldigte vorrangig die persönliche Kränkung erreichen wollte oder dies der Schwerpunkt des Gesamtwerkes wäre.
Demzufolge geht die Interessenabwägung zugunsten der Kunstfreiheit aus, deren Grenzen mit den Äußerungen, die Gegenstand des Raps sind, noch nicht überschritten ist. Eine Strafbarkeit scheidet aus gern. § 193 StGB iVm Art. 5 GG.
b) Beleidigung durch die Bezeichnung „Botoxfresse“
Dem Angeschuldigten zu 1. wird zudem zur Last gelegt, den Anzeigestatter in einem Facebookpost vom 13.02.2019 als „Botoxfresse“ bezeichnet zu haben, wobei der Beitrag mit dem Hashtag #machdichnichtübermoscheenlustig verlinkt gewesen ist.
Grundsätzlich ist unter der Beleidigung eine Kundgabe eines herabsetzenden Werturteiles zu verstehen, wobei bei der Frage, was eine Nichtachtung oder Missachtung der Person darstellt, regionale und subkulturelle Besonderheiten zu berücksichtigen sind und es auf die Frage ankommt, wie ein objektiver Dritter in der konkreten Situation den Erklärungsinhalt verstehen würde (Fischer, StGB, § 185, Rz. 8).
Reine Unhöflichkeiten, Distanzlosigkeit oder Äußerungen ohne einen allgemein abwertenden Charakter, auch wenn sie in derber Ausdrucksweise erfolgen, sind dabei nicht dem Tatbestand der Beleidigung gemäß § 185 StGB entsprechend (Fischer, Strafgesetzbuch § 185 Anmerkung 8c).
Vorliegend fühlt sich der Anzeigerstatter offenbar durch die Äußerung „Botoxfresse“ beleidigt.
Dieser Begriff lässt sich einerseits in dem Sinne verstehen, dass damit ein durch übermäßige kosmetische Eingriffe entstelltes Gesicht umschrieben wird.
Zwingend ist diese Auslegung indes nicht.
Nach dem regionalen Sprachgebrauch steht der Begriff „Fresse“ als derbes Synonym für „Gesicht“, wobei dem Begriff für sich genommen noch kein negatives Werturteil beigemessen wird, solange keine weitere negative Konnotation hinzukommt.
Eine „Botoxfresse“ könnte danach jemand sein, der sich einem Eingriff mit Botox unterzogen hätte, beispielsweise, um ein jugendlicheres äußeres Erscheinungsbild hervorzurufen. Dies stellt als solches nach dem allgemeinen Verständnis kein herabsetzendes Werturteil oder eine das Persönlichkeitsrecht missachtende Äußerung dar. Es ist gesellschaftlich gerade im Hinblick auf Prominente oder Menschen mit regelmäßigem Auftreten in Fernsehsendungen weder ungewöhnlich noch sozial geächtet, sich kosmetischen Eingriffen zu unterziehen. Selbst wenn der Angeschuldigte zu 1. sich darüber lustig gemacht hätte, ist eine ehrverletzende Auslegung dieses Begriffes durchaus nicht zwingend, sondern kann auch einen — zwar distanzlosen — aber hinsichtlich der persönlichen Ehre wertneutralen Charakter haben.
Des weiteren ist die Äußerung „Botoxfresse“ verlinkt mit dem Hashtag #machdichnichtübermoscheenlustig und knüpft insoweit direkt an das Video des Anzeigerstatters über die Moschee in Abu Dhabi an.
Unter Berücksichtigung dieser Verbindung kann die Äußerung „Botoxfresse“ auch ausgelegt werden in dem Sinne wie „eine dicke Lippe riskiert haben / eine große Klappe gehabt haben“, mithin also als Bezeichnung eines als großspurig bewerteten Verhaltens. Auch diese Auslegungsweise stellt als solche keine ehrverletzende Aussage dar.
Zusammengefasst sind aus Sicht des objektiven Adressaten vor dem Hintergrund der Verknüpfung mit dem Hashtag hierbei mehrere Auslegungen möglich, die nicht sämtlich ein herabwürdigendes Werturteil darstellen. Vielmehr steht die Mehrdeutigkeit der Äußerung der Einordnung als Beleidigung entgegen.
Selbst bei einer Auslegung der Äußerung als objektiv beleidigend ist immer noch zu bedenken, dass die Äußerung aufgrund der Verbindung mit dem Hashtag auf eine provozierende Äußerung des Anzeigerstatters Bezug nimmt, die dieser im Nachhinein als (missglückten) Witz darstellte. Insoweit liegt ein Sachbezug im Sinne einer Antwort auf die öffentliche als provozierend empfundene Äußerung des Anzeigeerstatters vor, die letztlich zu der Gegenäußerung führte.
…..“