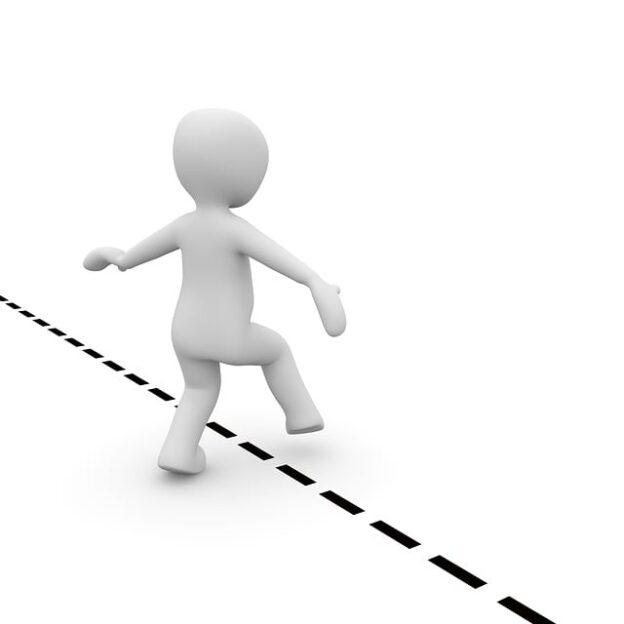Es ist mal wieder so weit: Heute gibt es Entscheidungen, die mit dem KCanG zusammenhängen.
Ich starte mit dem BGH, Beschl. v. 12.06.2024 – 1 StR 105/24 – eine der vielen Entscheidungen des BGH aus der letzten zeit zum CanG oder zum KCanG. Das LG hat den Angeklagten wegen verschiedener Verstöße gegen das BtMG verurteilt (wegen der Einzelheiten des umfangreichen LG-Tenors verweise ich auf den verlinkten Volltext.
Nach den Feststellungen des LG entschloss sich der Angeklagte zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt im Frühjahr oder Sommer 2022, sich zur Finanzierung seines eigenen Cannabiskonsums durch den Gewinn bringenden Verkauf von Cannabis eine „auf Dauer angelegte, erhebliche“ Einnahmequelle zu verschaffen. Dabei arbeitete er mit einem nicht identifizierbaren Freund dergestalt zusammen, dass er diesem jeweils die Hälfte des erworbenen Marihuanas übergab, welches der Freund – wie der Angeklagte wusste – zur Hälfte seinerseits Gewinn bringend weiterveräußerte, zur anderen Hälfte selbst konsumierte. Den ihm verbleibenden Teil des Marihuanas und das nur für seine Zwecke erworbene Haschisch veräußerte der Angeklagte zum überwiegenden Teil; den Rest konsumierte er selbst. Das LG hat dann im Einzelnen insgesamt (mindestens) fünf Taten festgestellt.
Die Revision des Angeklagten hatte Erfolg:
„Die auf die Sachrüge veranlasste umfassende Nachprüfung des Urteils führt zu dessen Aufhebung.
1. Der Schuldspruch hat keinen Bestand. Am 1. April 2024 ist das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (Konsumcannabisgesetz – KCanG) in Kraft getreten (BGBl. I Nr. 109), was der Senat nach § 2 Abs. 3 StGB i.V.m. § 354a StPO zu berücksichtigen hat. Nach der Neuregelung unterfällt der Umgang des Angeklagten mit Cannabis nicht mehr dem Betäubungsmittelgesetz, sondern allein dem – grundsätzlich milderen – Konsumcannabisgesetz (s. BGH, Beschluss vom 18. April 2024 – 1 StR 106/24 Rn. 3 ff.).
a) Einer Schuldspruchanpassung durch den Senat (§ 354 Abs. 1 StPO analog) steht § 265 Abs. 1 StPO entgegen. Der Angeklagte hätte sich möglicherweise gegen den aufgrund der bisherigen Feststellungen nach dem Konsumcannabisgesetz zu fassenden Schuldspruch wirksamer als bislang geschehen verteidigen können. Denn anstelle des unter dem Regelungsregime des Betäubungsmittelgesetzes hinsichtlich des zum Eigenkonsum erworbenen Cannabis angeklagten und ausgeurteilten Tatbestandes des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge kommt nach neuer Rechtslage der Tatbestand des Erwerbs von Cannabis (§ 34 Abs. 1 Nr. 12 KCanG) in Betracht, mithin eine andere Handlungsform, die überdies gegenüber dem Besitz von Cannabis eine niedrigere Freigrenze vorsieht und sich damit als für den Angeklagten ungünstiger erweist.
aa) Zwar entsprechen die unter Strafe gestellten Handlungsformen des Konsumcannabisgesetzes weitgehend denen des Betäubungsmittelgesetzes (vgl. BT-Drucks. 20/8704, S. 130). Auch ist hinsichtlich der konkurrenzrechtlichen Bewertung grundsätzlich auf die bisherige Rechtslage abzustellen (BGH, Beschluss vom 18. April 2024 – 1 StR 106/24 Rn. 5), weshalb in der Regel einer Schuldspruchanpassung durch das Revisionsgericht § 265 Abs. 1 StPO nicht entgegenstehen wird. Eine abweichende Bewertung kann indes in den Fällen veranlasst sein, in denen sich der Umgang mit Cannabis auf eine nicht geringe Menge bezieht. Denn das Betäubungsmittelgesetz unterstellt in dem Qualifikationstatbestand des § 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG nur die Handlungsformen des Handeltreibens, Herstellens, Abgebens und Besitzens einem höheren Strafrahmen. Dies hat u.a. zur Folge, dass die lediglich nach dem Grundtatbestand des § 29 Abs. 1 BtMG strafbaren Handlungsformen des Erwerbens und Sich-Verschaffens hinter dem spezielleren Tatbestand des Besitzes in nicht geringer Menge zurücktreten (vgl. Maier in Weber/Kornprobst/Maier, BtMG, 6. Aufl., § 29a Rn. 215). Demgegenüber sieht das Konsumcannabisgesetz für den – nicht qualifizierten (§ 34 Abs. 4 KCanG) – Umgang mit Cannabis in nicht geringer Menge keinen Qualifikationstatbestand, sondern ein alle in § 34 Abs. 1 KCanG unter Strafe gestellte Handlungsformen erfassendes Regelbeispiel vor.
Dies führt in den Fällen, in denen das Tatgericht unter dem Regelungsregime des Betäubungsmittelgesetzes zwar einen Erwerb von Cannabis in nicht geringer Menge zum Eigenkonsum festgestellt, jedoch gemessen an vorstehend dargestellten Maßstäben den Besitztatbestand nach § 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG ausgeurteilt hat, dazu, dass nach dem Konsumcannabisgesetz anstelle des Besitzes eine andere Handlungsform – hier der Erwerb von Cannabis (§ 34 Abs. 1 Nr. 12 KCanG) – in Betracht kommt.
bb) So liegt der Fall hier. Nach den Feststellungen erwarb der Angeklagte in den Fällen II.1. bis II.4. der Urteilsgründe Marihuana in nicht geringer Menge (auch) zum Eigenkonsum. Gemessen an vorstehenden Maßstäben ist daher nicht auszuschließen, dass sich der Angeklagte in Kenntnis der abweichenden rechtlichen Bewertung wirksamer als geschehen hätte verteidigen können.
b) Um dem neuen Tatgericht insgesamt widerspruchsfreie Feststellungen und eine einheitliche rechtliche Bewertung zu ermöglichen, hebt der Senat das Urteil auch im Fall II.5. der Urteilsgründe auf.
2. Für die neue Verhandlung und Entscheidung wird auf Folgendes hingewiesen:
a) Sollte das neue Tatgericht abermals Feststellungen dahin treffen, dass der Angeklagte seinem Freund die tatsächliche Herrschaft über zuvor erworbenes und in Empfang genommenes Cannabis zum Eigenkonsum überließ, kommt anstelle des Tatbestandes der Beihilfe zum Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge der Tatbestand der Abgabe von Cannabis (§ 34 Abs. 1 Nr. 7 KCanG) in Betracht.
b) Die in § 34 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 12 KCanG normierten Einschränkungen der Strafbarkeit des Besitzes, Anbaus und Erwerbs von Cannabis stellen Freigrenzen dar. Dies hat zur Folge, dass bei Überschreiten derselben die Handlung hinsichtlich des gesamten besessenen, angebauten oder erworbenen Cannabis strafbewehrt ist und das Cannabis als Bezugsgegenstand auch vollständig der Einziehung unterliegt (§ 37 KCanG, § 74 Abs. 2 StGB).
aa) Für dieses Verständnis ist zunächst der Wortlaut des § 34 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 12 KCanG heranzuziehen. Denn die Formulierung „mehr als“ … „besitzt“, „anbaut“ oder „erwirbt“ bedeutet lediglich, dass eine Strafbarkeit nur dann in Betracht kommt, wenn die jeweils genannte Menge überschritten ist. Dass die „erlaubten“ Mengen in jedem Fall aus der Strafbarkeit ausgenommen sein sollen, ergibt sich hieraus indes nicht. Aus der Bezugnahme auf § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 12 KCanG folgt nichts Anderes. Nach § 2 KCanG ist der Umgang mit Cannabis grundsätzlich verboten.
bb) Auch die Systematik des Konsumcannabisgesetzes und der Wille des Gesetzgebers sprechen hierfür; insbesondere führt die Entscheidung des Gesetzgebers, bestimmte Besitzmengen in §§ 3, 4 KCanG von dem in § 2 KCanG normierten Verbot des Umgangs mit Cannabis auszunehmen, zu keiner anderen Bewertung. Der Normgeber hat in §§ 3, 4 KCanG infolge einer „geänderten Risikobewertung“ von Cannabis für Erwachsene den Besitz bestimmter Mengen zum Eigenkonsum von dem grundsätzlichen Umgangsverbot des § 2 KCanG ausgenommen (BT-Drucks. 20/8704, S. 93). Zwar teilt die Gesetzesbegründung nicht mit, von welchen Erwägungen sich der Gesetzgeber bei der Festlegung der Mengen konkret hat leiten lassen. Angesichts dessen, dass das Konsumcannabisgesetz nach seiner Präambel einen verbesserten Gesundheitsschutz und die Stärkung eines „verantwortungsvolle[n] Umgang[s] mit Cannabis“ (vgl. BT-Drucks. 20/8704, S. 1) zum Ziel hat, ist jedoch davon auszugehen, dass sich die festgesetzten Mengen hieran orientieren und das äußerste Maß dessen darstellen, was mit Blick auf die – auch aus der Sicht des Gesetzgebers (vgl. BT-Drucks. 20/8704, S. 1) – grundsätzlich weiterhin gegebene Gefährlichkeit von Cannabis vor dem Hintergrund des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung noch verantwortet werden kann. Dies bedeutet, dass der Gesetzgeber den gleichzeitigen Besitz größerer als in §§ 3, 4 KCanG genannter Mengen als gefährlich angesehen und daher verboten hat (vgl. dazu BT-Drucks. 20/8704, S. 131: „erst bei Überschreiten … strafbar“). Da die Straftatbestände des § 34 KCanG der Durchsetzung der gesetzgeberischen Wertungen – mithin auch dem strikten Verbot, mehr als die in §§ 3, 4 KCanG genannten Mengen zu besitzen – dienen sollen, sind die Regelungen des § 34 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 12 KCanG als Freigrenzen zu verstehen.
c) Der geänderten Bewertung des Umgangs mit Cannabis durch den Gesetzgeber ist jedoch auf der Strafzumessungsebene Rechnung zu tragen. Denn die Wertung des Normgebers, den Besitz von Cannabis zum Eigenkonsum in einem bestimmten Maß zu erlauben und damit einhergehend den Besitz, Anbau und Erwerb zum Eigenkonsum nur bei Überschreiten bestimmter Grenzen unter Strafe zu stellen, wirkt sich auf den Schuldumfang aus (vgl. BGH, Beschluss vom 30. April 2024 – 6 StR 536/23 Rn. 27). Die in § 34 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 12 KCanG genannten Freigrenzen sind daher innerhalb der Straftatbestände des Besitzes, Anbaus und Erwerbs von Cannabis (§ 34 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 12 KCanG) bei der Bemessung der Strafe zu berücksichtigen (§ 267 Abs. 3 Satz 1 StPO).
Gleiches gilt für die innerhalb der Strafzumessungsregelung des § 34 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 KCanG zu bestimmende „nicht geringe Menge“. Der 1. Strafsenat schließt sich insoweit den Erwägungen des 6. Strafsenats in seiner Entscheidung vom 30. April 2024 (6 StR 536/23 Rn. 29 f.) an, wonach in Bezug auf die Besitztatbestände des § 34 KCanG die nicht unter Strafe gestellten Mengen von 60 bzw. 30 Gramm oder – im Zusammenhang mit Anbauvereinigungen – von 25 bzw. 50 Gramm im Monat bei der Berechnung der „nicht geringen Menge“ außer Betracht bleiben müssen. Diese Wertung ist auf den Erwerbstatbestand des § 34 Abs. 1 Nr. 12 KCanG zu übertragen.“