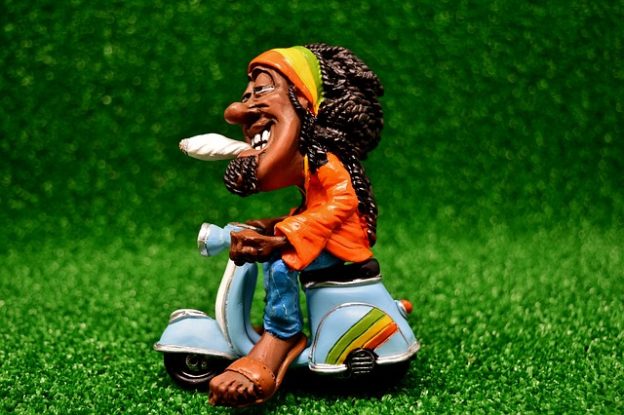Und dann heute StPO-Entscheidungen – aus der Instanz. Na ja, fast 🙂
Ich erinnere. Das LB Berlin hatte mit dem LG Berlin, Beschl. v. 01.07.2021 – (525 KLs) 254 Js 592/20 (10/21); dem EuGH einige Fragen zur Verwertbarkeit der durch die EncroChat-Übewachung gewonnenen Ergebnisse vorgelegt (vgl. dazu Sondermeldung zur Verwertbarkeit von EncroChat, oder: Endlich Vorlage an den EuGH durch das LG Berlin.
Inzwischen hat sich, worüber ja auch schon an anderen Stellen berichtet worden ist, der EuGH zu den Voraussetzungen für die Übermittlung und Verwendung von Beweismitteln in grenzüberschreitenden Strafverfahren geäußert und die präzisiert. Dabei hat er die deutsche Rspr. bestätigt, wonach die Staatsanwalt Daten, die von ausländischen Behörden gewonnen werden, auch dann verwenden dürfen, wenn die Maßnahme in Deutschland nicht zulässig gewesen wäre (EUGH, Urt. v. 30.4.2024 – C-670/22).
Ich will hier jetzt nicht – die immer – ein wenig schwer lesbare Entscheidung des EuGH einstellen, sondern nur die Grundzüge der Entscheidung mtteilen, die sich etwa wie folgt zusammenfassen lassen:
- Eine EAA, die auf die Übermittlung von Beweismitteln gerichtet ist, die sich bereits im Besitz der zuständigen Behörden des Vollstreckungsstaats (hier: Frankreich) befinden, muss nicht notwendigerweise von einem Richter erlassen werden. Sie kann von einem StA erlassen werden, wenn dieser in einem rein innerstaatlichen Verfahren dafür zuständig ist, die Übermittlung bereits erhobener Beweise anzuordnen.
- Der Erlass einer solchen EAA unterliegt denselben materiell-rechtlichen Voraussetzungen, wie sie für die Übermittlung ähnlicher Beweismittel bei einem rein innerstaatlichen Sachverhalt gelten. Es ist nicht erforderlich, dass er denselben materiell-rechtlichen Voraussetzungen unterliegt, wie sie für die Erhebung der Beweise gelten. Jedoch muss ein Gericht, das mit einem Rechtsbehelf gegen diese Anordnung befasst ist, die Wahrung der Grundrechte der betroffenen Personen überprüfen können.
- Der EuGH stellt außerdem klar, dass der Mitgliedstaat, in dem sich die Zielperson der Überwachung befindet, von einer mit der Infiltration von Endgeräten verbundenen Maßnahme zur Abschöpfung von Verkehrs-, Standort- und Kommunikationsdaten eines internetbasierten Kommunikationsdienstes unterrichtet werden muss. Die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats hat dann die Möglichkeit, mitzuteilen, dass die Überwachung des Telekommunikationsverkehrs nicht durchgeführt werden kann oder zu beenden ist, wenn diese Überwachung in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall nicht genehmigt würde.
- Das nationale Strafgericht muss in einem Strafverfahren gegen eine Person, die der Begehung von Straftaten verdächtig ist, Beweismittel unberücksichtigt lassen, wenn die betroffene Person nicht in der Lage ist, zu ihnen Stellung zu nehmen, und wenn sie geeignet sind, die Würdigung der Tatsachen maßgeblich zu beeinflussen.
So traurig es ist: Aus der Entscheidung des EuGH lässt sich wohl kein Beweisverwertungsverbot VV hinsichtlich der EncroChat- bzw. SkyECC-Daten entnehmen. Und auf der Linie liegt dann auch gleich eine LG Entscheidung, und zwar der LG Kiel, Beschl. v. 08.05.2024 – 7 KLs 593 Js 18366/22 -, der weiterhin die Verwertbarkeit von Encrocaht bejaht:
„Auch aus der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 30.04.2024 betreffend EncroChat lässt sich – entgegen den Ausführungen der Verteidigung in der Haftbeschwerde – kein Beweisverwertungsverbot hinsichtlich der EncroChat- bzw. SkyECC-Daten entnehmen. Der Europäische Gerichtshof hat in der Entscheidung u.a. ausgeführt, dass Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2014/41 nicht dem Erlass einer Europäischen Ermittlungsanordnung entgegensteht, wenn die Integrität der durch die Überwachungsmaßnahme erlangten Daten wegen der Vertraulichkeit der technischen Grundlagen, die diese Maßnahme ermöglicht haben, nicht überprüft werden kann, sofern das Recht auf ein faires Verfahren im späteren Strafverfahren gewährleistet ist. Die Integrität der übermittelten Beweismittel kann grundsätzlich nur zu dem Zeitpunkt beurteilt werden, zu dem die zuständigen Behörden tatsächlich über die fraglichen Beweismittel verfügen (EuGH, Urt . v. 30.04.2024, Az. C-670/22, Rn. 90). Darüber hinaus ist die Europäische Ermittlungsanordnung ein Instrument der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen im Sinne von Art. 82 Abs. 1 AEUV, die auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und Entscheidungen beruht. Dieser Grundsatz, der den „Eckstein“ der Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen bildet, beruht seinerseits auf dem gegenseitigen Vertrauen sowie auf der widerlegbaren Vermutung, dass andere Mitgliedstaaten das Unionsrecht und insbesondere die Grundrechte einhalten. Daraus folgt, dass die Anordnungsbehörde, wenn sie mittels einer Europäischen Ermittlungsanordnung um Übermittlung von Beweismitteln ersucht, die sich bereits im Besitz der zuständigen Behörden des Vollstreckungsstaats befinden, nicht befugt ist, die Ordnungsmäßigkeit des gesonderten Verfahrens zu überprüfen, mit dem der Vollstreckungsmitgliedstaat die Beweise, um deren Übermittlung sie ersucht, erhoben hat. Insbesondere würde eine gegenteilige Auslegung von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2014/41 in der Praxis zu einem komplexeren und weniger effizienten System führen, das dem mit der Richtlinie verfolgten Ziel abträglich wäre (vgl. EuGH, Urt. v. 30.04.2024, Az. C-670/22, Rn. 99 f.). In einem Strafverfahren im Anordnungsstaat ist bei der Bewertung. der mittels einer Europäischen Ermittlungsanordnung erlangten Beweismittel sicherzustellen, dass die Verteidigungsrechte gewahrt und ein faires Verfahren gewährleistet wird, was impliziert, dass ein Beweismittel, zu dem eine Partei nicht sachgerecht Stellung nehmen kann, vom Strafverfahren auszuschließen ist (vgl. EuGH, Urt. v. 30.04.2024, Az, C-670/22, Rn. 130).
Diese Ausführungen des Europäischen Gerichtshofes sind auch auf die SkyECC-Daten übertragbar.
Die Kammer ist davon überzeugt, dass die Verteidigungsrechte des Angeklagten gewahrt sind und ein faires Verfahren gewährleistet wird. Insbesondere *besteht für den Angeklagten die Möglichkeit zu sämtlichen vorliegenden Daten sachgerecht Stellung zu nehmen. Es liegen zudem die französischen Beschlüsse im Zusammenhang mit der Erhebung der SkyECC-Daten vor (SB französische Beschlüsse I und II), sodass die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Verfahrensbeteiligten nachprüfbar waren und sind. Hinsichtlich der Übereinstimmung der im‘ hiesigen Verfahren zu Grunde liegenden Daten mit den durch die französischen, Behörden übermittelten SkyECC-Daten hat die Kammer bereits Beweis erhoben durch Vernehmung des.Zeugen pp. des LKA .Kiel, u.a. über .dessen durchgeführten Datenabgleich. Danach ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Datenverfälschung in Deutschland. ‚Soweit es den französischen Bereich betrifft, gibt es ebenfalls keine Anhaltspunkte dafür, dass die Daten fehlerhaft und inhaltlich verfälschend aufgezeichnet und ausgewertet worden sind. Widersprüche bei den Zahlen und sonstigen Datenwiedergaben sieht die Kammer nicht. Dabei übersieht die Kammer nicht, dass die Chats die Kommunikation nicht lückenlos wiedergeben. Das hat sie berücksichtigt und wird es weiter berücksichtigen.“
Nach der EuGH-Entscheidung wird man sich fragen (müssen), ob eigentlich EncroChat noch ein „vernünftiger“ Verteidigungsansatz ist. Jedenfalls wird das Verteidigen mit EncroChat sicherlich nicht leichter.