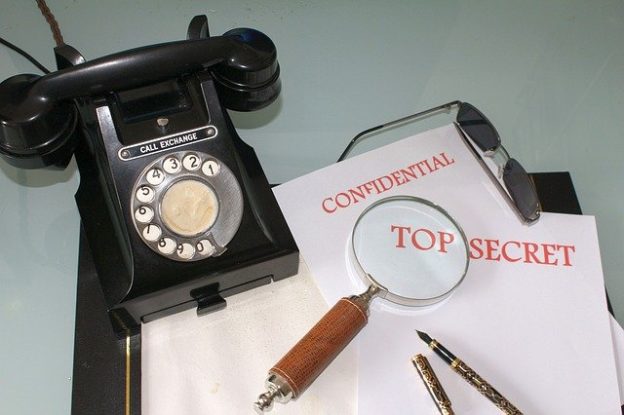Und dann heute ein paar StPO-Entscheidungen – und zwar alle vom BGH.
Ich beginne mit dem BGH, Beschl. v. 09.01.2025 – 1 StR 142/24 – zum Dauerbrenner: Verwertung von Daten aus der Überwachung von Messengerdiensten. Stichwort: Encro-Chat. In dem Beschluss des ersten Strafsenats geht es um die Verwertung von SkyECC-Kommunikationsüberwachungsdaten.
Ich erspare mir (und dem Leser) den (technischen) Sachverhalt. Das dürfte bekannt sein. Mit der Verfahrensrüge wird dann die Unverwertbarkeit der Daten geltend gemacht. Ohne Erfolg:
„bb) Die Verfahrensrüge dringt nicht durch.
(a) Sie ist bereits unzulässig, weil sie in einem für maßgeblich gehaltenen, von der Stoßrichtung umfassten Punkt nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechend vorträgt (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 19. Mai 2021 – 1 StR 509/20 unter 1. mwN); dies schlägt auf die Verfahrensrüge insgesamt durch. Die Revision behauptet, die deutschen Strafverfolgungsbehörden hätten spätestens ab März 2020 von der laufenden SkyECC-Kommunikationsüberwachung gewusst und diese entgegen ihrer Verpflichtung aus § 91g Abs. 6 IRG nicht untersagt; hierin unterscheide sich die Beweiserhebung maßgeblich von den sogenannten EncroChat-Fällen. Die Verfahrensbeanstandung stützt sich insoweit auf einen verfahrensfremden Vermerk des Bundeskriminalamts vom 17. Juni 2021, in dem auf der ersten Seite ausgeführt wird, die SkyECC-Überwachung sei im März 2020 durch eine mediale Berichterstattung allgemein bekannt geworden. Dass es sich bei der Datumsangabe „März 2020“ um ein Schreibversehen handelt, ergibt sich zum einen aus dem Vermerk selbst. Denn dort wird auf Seite fünf angegeben, im März 2021 sei über Europol bekannt geworden, dass bei Ermittlungen in Frankreich Daten des Kryptodienstes SkyECC erhoben worden seien. Allein dies deckt sich zum einen mit der am 10. März 2021 durch Europol veröffentlichten Pressemitteilung über den „Aktionstag“ vom 9. März 2021. Zum anderen belegt der gesamte zeitliche Ablauf der Ermittlungen, dass die Strafverfolgungsbehörden SkyECC-Daten erst Ende des Jahres 2020 entschlüsseln konnten; vorher wurde darüber wegen der Gefährdung des Ermittlungserfolgs nicht in den Medien berichtet.
(b) Im Übrigen hätte die Verfahrensrüge auch in der Sache keinen Erfolg. Die von den französischen Strafverfolgungsbehörden erhobenen und im Wege der Beweismittelrechtshilfe für deutsche Strafverfolgungszwecke zur Verfügung gestellten Daten von SkyECC-Nutzern sind verwertbar. Aufgrund des ähnlichen Verfahrensablaufs wie bei Verwertung der über den Messengerdienst EncroChat erhobenen und transferierten Daten gelten die in der Grundsatzentscheidung des 5. Strafsenats des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 2. März 2022 – 5 StR 457/21, BGHSt 67, 29 Rn. 24 ff.) aufgestellten Maßstäbe. Mit Blick auf die im Anschluss ergangenen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, Urteil vom 30. April 2024 – C-670/22) und des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 1. November 2024 – 2 BvR 684/22) ist ergänzend auszuführen:
(aa) Die Beweismittelgewinnung der französischen Behörden verstößt nicht gegen wesentliche rechtsstaatliche Grundsätze im Sinne des nationalen oder europäischen ordre public (vgl. Artikel 1 Abs. 4 RL EEA, § 73 IRG). Aus der Beschlagnahme der SkyECC-Telefone zusammen mit dem Betäubungsmittelfund im Hafen von An. ergab sich ein Anfangsverdacht für die Begehung von Betäubungsmittelstraftaten. Dieser wurde durch die dargestellten Besonderheiten der Telefone, dem Verhalten der kanadischen Firma und der Auswertung der 9.000 Chat-Nachrichten von französischen SkyECC-Nutzern erhärtet. Dass bei einer solchen Verdachts- und Beweislage zunächst ein Ermittlungsverfahren gegen die Betreiber des Unternehmens eingeleitet und im Zuge dessen die zeitlich befristete Erhebung aller Nutzerdaten des SkyECC-Dienstes richterlich angeordnet und überprüft wird, lässt – wie bei der Überwachung der EncroChat-Nutzer (vgl. hierzu BGH aaO Rn. 34 ff.) – auch angesichts der Gesamtdauer der Überwachung, die ersichtlich der zunächst erforderlichen Analyse der Server zur Entwicklung einer Entschlüsselungslösung geschuldet war, grundlegende Rechtsstaatsdefizite oder einen Verstoß gegen menschen- oder europarechtliche Grundwerte nicht erkennen. Auch eingedenk der großen Anzahl der überwachten Mobilfunkanschlüsse sind die Ermittlungsmaßnahmen weit von geheimdienstlichen „anlasslosen Massenüberwachungen und Massendatenauswertungen“ entfernt. Der Austausch der Nachrichten wurde nicht aufgrund eines allgemeinen Verdachts gegen eine verschlüsselte Kommunikationsinfrastruktur überwacht, sondern – wie zuvor aufgezeigt – aufgrund konkreter Verdachtsmomente. Die französischen Behörden gingen ersichtlich davon aus, dass der gezielt auf die Bedürfnisse der organisierten Kriminalität ausgerichtete Absatzweg gepaart mit den erheblichen Kosten des Erwerbs und Betriebs der Krypto-Telefone sowie des durch die Ermittlungen bestätigten kriminellen Einsatzbereichs die Erfassung Unverdächtiger ausschloss.
(bb) Aus dem Verstoß der französischen Behörden gegen die Pflicht zur Benachrichtigung des von einer grenzüberschreitenden Telekommunikationsüberwachung betroffenen Zielstaates Deutschland aus Artikel 31 RL EEA bzw. gegen die diese Vorgaben umsetzende französische Vorschriften (wonach die RL EEA unmittelbar in die französische Rechtsordnung integriert wurde, vgl. hierzu BGH, aaO Rn. 39 mwN) folgt kein Beweisverwertungsverbot. Zwar handelt es sich bei Artikel 31 RL EEA um eine rechtshilferechtliche Bestimmung, die neben der Achtung der Souveränität des zu unterrichtenden Zielstaats auch den Schutz der Zielperson u.a. vor einer Verwendung der Daten in diesem Mitgliedstaat – hier also Deutschland – bezweckt (vgl. EuGH, Urteil vom 30. April 2024 – C-670/22 Rn. 121, 124 und 125) und somit individualschützenden Charakter hat. Aber bei der gebotenen Abwägung der widerstreitenden Interessen überwiegt das des Staates an einer umfassenden Aufklärung besonders schwerer Straftaten. Insoweit gilt (vgl. nur BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 1. November 2024 – 2 BvR 684/22 Rn. 98; Beschluss vom 7. Dezember 2011 – 2 BvR 2500/09 und 1857/10, BVerfGE 130, 1 Rn. 117 mwN):
(1) Nicht jeder Verstoß gegen Beweiserhebungsvorschriften zieht ein strafprozessuales Verwertungsverbot nach sich; darüber ist nach den Umständen im Einzelfall, insbesondere nach der Art der verletzten Vorschrift und dem Gewicht des Verstoßes unter Abwägen der widerstreitenden Interessen zu entscheiden. Nur ausnahmsweise ist ein Beweisverwertungsverbot aufgrund gesetzlicher Vorschrift wie etwa § 136a Abs. 3 Satz 2 StPO oder aus übergeordneten wichtigen Gründen anzunehmen. Denn ein Beweisverwertungsverbot schränkt eines der wesentlichen Prinzipien des Strafverfahrensrechts ein, und zwar den Grundsatz, dass das Gericht die Wahrheit zu erforschen und dazu die Beweisaufnahme von Amts wegen auf alle Tatsachen und Beweismittel zu erstrecken hat, die von Bedeutung sind. Maßgeblich beeinflusst wird das Ergebnis der danach vorzunehmenden Abwägung einerseits durch das Ausmaß des staatlichen Aufklärungsinteresses, dessen Gewicht im konkreten Fall vor allem unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit weiterer Beweismittel, der Intensität des Tatverdachts und der Schwere der Straftat bestimmt wird. Andererseits ist das Gewicht des in Rede stehenden Verfahrensverstoßes von Belang, das sich vor allem danach bemisst, ob das staatliche Ermittlungsorgan den Rechtsverstoß gutgläubig, fahrlässig oder vorsätzlich begangen hat. Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist ein Beweisverwertungsverbot geboten, wenn die Auswirkungen des Rechtsverstoßes dazu führen, dass dem Angeklagten keine hinreichenden Möglichkeiten zur Einflussnahme auf Gang und Ergebnis des Verfahrens verbleiben, die Mindestanforderungen an eine zuverlässige Wahrheitserforschung nicht mehr gewahrt sind oder die Informationsverwertung zu einem unverhältnismäßigen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht führen würde. Zudem darf eine Verwertbarkeit von Informationen, die unter Verstoß gegen Rechtsvorschriften gewonnen wurden, nicht bejaht werden, wenn dies zu einer Begünstigung rechtswidriger Beweiserhebungen führen würde. Ein Beweisverwertungsverbot kann daher insbesondere nach schwerwiegenden, bewussten oder objektiv willkürlichen Rechtsverstößen, bei denen grundrechtliche Sicherungen planmäßig oder systematisch außer Acht gelassen worden sind, geboten sein.
(2) Nach diesen Maßstäben folgt aus einem Verstoß gegen die Benachrichtigungspflicht kein Beweisverwertungsverbot: Es geht um die Aufklärung besonders schwerwiegender Straftaten im Sinne des § 100b Abs. 2 StPO, nämlich Verbrechen nach § 30a Abs. 1 BtMG, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von 15 Jahren bedroht sind (vgl. zur Notwendigkeit der effektiven Bekämpfung solcher Straftaten; BVerfG, Urteil vom 19. März 2013 – 2 BvR 2628/10 u.a., BVerfGE 133, 168 Rn. 57; Rahmenbeschluss 2004/757/JI des Rates vom 25. Oktober 2004 zur Festlegung von Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die Strafen im Bereich des illegalen Drogenhandels, ABl. L 335, S. 8). Andere Beweismittel stehen hier für die Überführung des Angeklagten nicht zur Verfügung. Die SkyECC-Protokolle sind als Beweismittel besonders ergiebig, da die Beteiligten darin offen über Drogengeschäfte in erheblichem Umfang kommunizierten. Der Angeklagte konnte sich im Strafprozess auch mittelbar gegen die Abhörmaßnahme durch einen Verwertungswiderspruch wehren, so dass er unter anderem hierdurch seine Verteidigungsrechte effektiv wahren konnte (vgl. zu diesem Erfordernis EuGH, Urteile vom 30. April 2024 – C-670/22 Rn. 130 und vom 6. Oktober 2020, La Quadrature du Net u.a. – C-511/18, C-512/18, C-520/18 Rn. 226). Demgegenüber fällt der Umstand, dass den französischen Behörden bereits früh klar war, dass die Überwachung der Telekommunikation eine Vielzahl von Personen in anderen Ländern betrifft, wegen des geringen Grads der Persönlichkeitsrelevanz der Chatnachrichten nicht erheblich ins Gewicht. Zudem durfte der Kernbereich der Lebensführung infolge der Einschränkung der Beschlagnahmeanordnung nicht aufgezeichnet werden.
(cc) Gegen Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b RL EEA ist ebenfalls nicht verstoßen worden.
(1) Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b RL EEA, der die EEA zur Übermittlung von Beweismitteln regelt, die sich bereits im Besitz der zuständigen Behörde des Vollstreckungsstaates befinden, setzt für deren Rechtmäßigkeit voraus, dass die Übermittlung in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall unter denselben Bedingungen hätte angeordnet werden können. Dagegen verlangt Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b RL EEA gerade nicht, dass der Erlass einer EEA, die auf einen Beweismitteltransfer gerichtet ist, denselben materiell-rechtlichen Voraussetzungen unterliegt, wie sie im Anordnungsstaat (Deutschland) für die Erhebung dieser Beweise gelten (vgl. EuGH, Urteil vom 30. April 2024 – C-670/22 Rn. 91 ff.). Selbst unter Heranziehung einer Online-Durchsuchung nach § 100b StPO, deren Erkenntnisse der strafprozessual restriktivsten Verwendungsschranke des § 100e Abs. 6 StPO unterliegen, hätten die Beweismittel in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall unter den gleichen Bedingungen übermittelt werden können. Die deutschen Strafverfolgungsbehörden ersuchten die französischen Behörden in einem gegen namentlich bekannte Beschuldigte geführten Ermittlungsverfahren u.a. wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge (§ 30a Abs. 1 BtMG), mithin einer Katalogtat nach § 100b Abs. 2 Nr. 5 Buchstabe b StPO, um Übermittlung von Inhaltsdaten konkreter SkyECC-Nutzer. Der Tatverdacht, der auch im Einzelfall besonders schwer wog (§ 100b Abs. 1 Nr. 2 StPO), ergab sich aus technischen Überwachungsmaßnahmen, der Beschlagnahme des Marihuanas sowie der Sicherstellung und Auswertung der von gesondert verfolgten Beschuldigten genutzten SkyECC-Telefone. Das weitere Aufklären des Sachverhalts sowie die Ermittlung der an der Tatbegehung maßgeblich beteiligten, durch die jeweiligen SkyECC-IDs konkretisierten, jedoch noch namentlich unbekannten Personen wie der Angeklagte wären ohne diese Beweismittel nicht möglich gewesen. Die sich hieraus gegen den Angeklagten nach § 100b Abs. 1 und Abs. 2 StPO ergebende erforderliche Verdachtslage, die auch im Einzelfall schwer wiegt, bestand spätestens im Verwertungszeitpunkt der Beweisergebnisse (vgl. dazu BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 1. November 2024 – 2 BvR 684/22 Rn. 99; BGH, aaO Rn. 70 mwN). Die Daten betreffen zudem keine Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung (§ 100d Abs. 2 Satz 1 StPO).
(2) Schließlich führt die Neuregelung durch das KCanG zu keiner anderen Beurteilung. Denn das bandenmäßige Handeltreiben mit Cannabis in nicht geringer Menge (§ 34 Abs. 4 Nr. 3 KCanG) ist Katalogtat der Online-Durchsuchung (§ 100b Abs. 2 Nr. 5a StPO).
(dd) Ein Beweisverwertungsverbot ergibt sich letztlich auch nicht aus einem Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Beschwerdeführers.“