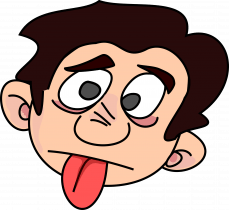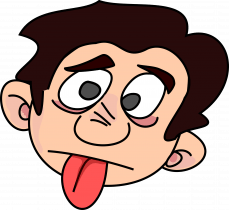
entnommen openclipart.org
Heute dann ein wenig Verfahrensrecht. Und den Reigen der Entscheidungen eröffnet das BGH, Urt. v. 06.03.2018 – 1 StR 277/17, ergangen zu Belehrungsmängeln/-fehlern und einem Beweisverwertungsverbot.
Das LG hat die Angeklagten M. und R. wegen vorsätzlicher Brandstiftung verurteilt. Nach den Feststellungen der Strafkammer kam es bei einem im Dezember 2013 abgeschlossenen Mietverhältnis der M. und R. mit dem Vermieter zu Mietstreitigkeiten, welche zu einem Räumungsprozess führten, der am 13.05.2016 durch einen Vergleich beendet wurde. Hierauf gestützt wurde vom zuständigen Gerichtsvollzieher die Zwangsräumung für den 19.07.2016 festgesetzt. An diesem Tag wurde an/in dem Mietobjekt ein Brand gelegt. Das LG hat sich seine Überzeugung hinsichtlich der Täterschaft der beiden Angeklagten u.a. maßgeblich auf Grund der Angaben der Angeklagten R. gegenüber einem behandelnden Arzt D. im Beisein der Zeugin KHMin K. gebildet. Die Angeklagte R. hat die Verfahrensrüge erhoben und u.a. beanstandet u.a., dass sie unter Verletzung auf ihr Recht zu Schweigen polizeilich vernommen und „unmenschlich behandelt“ worden sei, sie berufe sich auf „§ 136 Abs. 1 S. 2, 136a Abs. 1 S. 1 StPO“ und „Art. 3 MRK“.
Die Verfahrensrüge hatte Erfolg. Der BGH ist in etwa von folgendem Verfahrensgeschehen ausgegangen: Die Angeklagte R. wurde noch im Bereich des Brandobjektes durch KHK Ra. über ihre Rechte nach §§ 136, 163a StPO belehrt. Sie äußerte daraufhin, wie auch ihre mitangeklagte Tochter, die Angeklagte M., zur Sache nicht aussagen zu wollen. In der Folge wurden die beiden Angeklagten in unterschiedlichen Polizeifahrzeugen ins Klinikum Ro. verbracht, um mögliche gesundheitliche Folgen der Raucheinwirkungen abklären zu lassen. Mit der Begleitung der Angeklagten R. war die Kriminalbeamtin KHMin K. beauftragt worden, welche, wie bei der Kriminalpolizei üblich, Zivilkleidung trug. Auf dem Weg zum Auto fragte die Angeklagte R. die Beamtin, obgleich es hierfür keinen Anlass gab, ob sie Ärztin sei, was diese verneinte und auf ihren Polizeibeamtenstatus hinwies.
Im Krankenhaus wartete die Zeugin KHMin K. mit der Angeklagten auf den zuständigen Arzt D., wobei die Beamtin das Gespräch mit der Angeklagten in Kenntnis dessen fortführte, dass sich diese vor einem Gespräch mit einem Rechtsanwalt nicht zur Sache äußern wollte. Als der Arzt eintraf, ging sie zusammen mit der Angeklagten in das Behandlungszimmer. Als die Angeklagte sich zur Untersuchung durch den Arzt teilweise entkleidete, fragte sie, ob sie hinausgehen sollte, erhielt jedoch weder vom Arzt noch der Angeklagten irgendeine Antwort, worauf sie im Raum verblieb. Die Angeklagte gab auf Befragen des Arztes an, sie habe, genauso wie ihre Tochter, die Angeklagte M., zehn Tabletten des Medikamentes Sertralin genommen. Zudem wäre viel Rauch entstanden. Sie hätten „Benzin ausgeschüttet und das ausgeschüttete Benzin angezündet, überall im Erdgeschoss“, davor hätten sie „Tabletten genommen“. Nachdem die Angeklagte auf Fragen des Arztes zur Brandentstehung und -entwicklung wie vorstehend geantwortet hatte, verließ die Zeugin KHMin K. kurz den Raum, um sich bei ihren Kollegen zu vergewissern, dass die Angeklagte bereits belehrt worden sei, und ging dann – nach Bejahung der Frage – in den Untersuchungsraum zurück, wo sie bis zum Ende der ärztlichen Untersuchung verblieb.
Danach begleitete die Zeugin KHMin K. die Angeklagte R. zur Bewachung auf die Intensivstation des Krankenhauses, für die sie bis 18.45 Uhr abgestellt war. Auch dort kam es zu weiteren Gesprächen, nachdem die Angeklagte die Zeugin KHMin K. mehrfach an ihr Bett kommen ließ, um in Erfahrung zu bringen, wie es ihrer Tochter gehe. Dabei äußerte sie u.a. wörtlich, dass sie einfach „nicht mehr konnten“ und „wir haben einfach alles angezündet“.
Am nächsten Morgen transportierten die Zeugen KHK S. und KHK F. die Angeklagte zur Vorführung zum Amtsgericht, wobei sie erneut belehrt wurde. Nach der Belehrung führte der Zeuge KHK F. ein „Gespräch“, in dem sich die Angeklagte R. dahingehend einließ, dass „alles zu viel gewesen sei“.
Der Verwertung dieser Angaben – nach der Berufung auf das Schweigerecht der Angeklagten R. – haben beide Angeklagte am zweiten Hauptverhandlungstag vor der Vernehmung der Ermittlungsbeamten widersprochen. Trotz des Widerspruchs hat die Strafkammer ihre Überzeugung von der Mittäterschaft der Angeklagten R. und M. insbesondere auf die Aussagen der Zeugen KHMin K. und KHK F. gestützt. Die Angaben gegenüber dem Zeugen KHK Ra. am Tatort hat sie nicht verwertet. Hinsichtlich der Verwertung der Angaben im Behandlungszimmer hatte die Strafkammer – im Gegensatz zur Vernehmung durch KHK Ra. – keine Bedenken, da der Angeklagten R. bewusst gewesen sei, dass die Polizistin den Untersuchungsraum nicht verlassen habe. Die Angaben am Krankenbett hält die Strafkammer für verwertbare freiwillige Spontanäußerungen außerhalb einer Vernehmungssituation, die Angaben gegenüber dem Zeugen KHK F. seien nach erneuter Belehrung eigenverantwortlich und aus freiem Willen erfolgt.
Ist ein bisschen viel Sachverhalt, aber den braucht man, um die Entscheidung des BGH zu verstehen. Denn der BGH sieht die verfassungsrechtlich garantierte Selbstbelastungsfreiheit der Angeklagten R. als verletzt, was zu einem Beweisverwertungsverbot führe. Dazu verweist er auf die Rechtsprechung des BVerfG – bitte selbst nachlesen – , wonach die Aussagefreiheit des Beschuldigten und das Verbot des Zwangs zur Selbstbelastung (nemo tenetur se ipsum accusare) notwendiger Ausdruck einer auf dem Leitgedanken der Achtung der Menschenwürde beruhenden rechtsstaatlichen Grundhaltung seien. Der Beschuldigte müsse frei von Zwang eigenverantwortlich entscheiden können, ob und ggf. inwieweit er im Strafverfahren mitwirkt. Eine solche eigenverantwortliche Entscheidung sei bei der Angeklagten R. nicht gegeben. Dies ergebe – so der BGH – eine Gesamtbewertung der Vorgänge um die Zuführung der Angeklagten zu dem Arzt D. und die dort stattgefundene Untersuchung. Entscheidend ist für den BGH, dass sich die Angeklagte nach der ersten Belehrung im ununterbrochenen polizeilichen Gewahrsam befand, in dem zu keinem Zeitpunkt auf ihr Recht zu Schweigen Rücksicht genommen wurde.
Letztlich sei sie auf diese Weise einer dauerhaften Befragung ausgesetzt gewesen. Das habe schon während des Transports der Angeklagten zum Arzt begonnen, obwohl die Angeklagte zuvor ausdrücklich von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht hatte. Sie sei zudem in einer gesundheitlich sehr angeschlagenen Verfassung gewesen und hatte eine Überdosis Psychopharmaka zu sich genommen und befand sich bei deutlich erhöhter Pulsfrequenz in der Angst, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Schon diese prekäre gesundheitliche Verfassung der dezidiert nicht aussagebereiten Angeklagten R. habe weitere Fragen verboten. Weiterhin hätten die Gesamtumstände der ärztlichen Untersuchung der dringend behandlungsbedürftigen Angeklagte R. in ihrer Aussagefreiheit beeinträchtigt. Um einen korrekten ärztlichen Befund zu erhalten, sei sie gezwungen gewesen, möglichst genaue Angaben zur Brandentstehung zu machen, auch wenn dies mit einer Selbstbelastung einherging. Diese Zwangssituation habe die Zeugin KHMin K. mit ihrer Anwesenheit bewusst ausgenutzt, um die entsprechenden Erkenntnisse zu erheben, gerade weil sie genau wusste, dass die Angeklagte erklärt hatte, keine Angaben gegenüber den Ermittlungsbehörden machen zu wollen. Unerheblich sei, dass die Polizeibeamtin im Behandlungszimmer die Frage gestellt hatte, ob sie hinausgehen solle, ohne allerdings irgendeine Antwort zu erhalten. Dies habe sie nicht automatisch als Zustimmung werten können, weil auch die Möglichkeit bestand, dass die Frage weder vom Arzt noch der Angeklagten gehört worden war, zumal die Zeugin aus dem Vorgeschehen entnehmen musste, dass die bereits ältere Angeklagte in ihrer Orientierung offensichtlich beeinträchtigt war.
Tja, Angeklagte/Beschuldigte unter „Dauerbeschuss“. Das konnte m.E. nicht gut gehen. Denn die Angeklagte hatte recht früh geäußert, dass sie nicht aussagen wolle. Und danach hat dann Schluss zu sein mit Befragungen. Wer das nicht hören will, muss eben fühlen = ein Beweisverwertungsverbot hinnehmen. Die Kammer muss es jetzt noch einmal machen/versuchen, allerdings ohne die Äußerungen/Angaben, die einem Beweisverwertungsverbot unterliegen.
Und für Verteidiger: Widerspruch nicht vergessen!