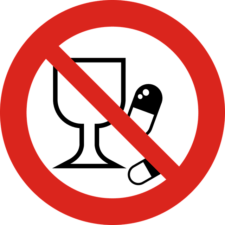Die zweite Entscheidung kommt dann auch vom AG Landstuhl. Im AG Landstuhl, Urt. v. 09.02.2024 – 3 OWi 4211 Js 11910/23 – geht es um die Rechtsfolgen bei einer vorsätzlichen Geschwindigkeitsüberschreitung.
Das AG hat den Betroffenen wird wegen vorsätzlicher Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften zu einer Geldbuße von 1.160 EUR verurteilt und außerdem ein Fahrverbot von einem Monat verhängt.
Dre Betroffene war auf einer BAB anstelle der zulässigen 80 km/h mit 133 km/h gefahren. Der Betroffene ist verkehrsrechtlich bislang auch schon einige Male in Erscheinung getreten, und zwar gibt es eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis am 21.12.2013, die Verurteilung nach § 316 StGB am 09.01.2014 zu einer Geldstrafe mit einer Maßregel nach §§ 69, 69a StGB, einen Abstandsverstoß am 22.2.2022 und einen Geräteverstoß.
Das AG begründet seine Rechtsfolgenentscheidung wie folgt:
„Durch den genannten Verstoß hat der Betroffene zunächst eine Geldbuße zu tragen. Diese ergibt sich zunächst als Regelsatz in Höhe von 480 EUR gemäß Ziffer 11.3.8 des Anhangs zur BKatV, die für das Gericht in Regelfällen einen Orientierungsrahmen bildet (BeckOK StVR/Krenberger, § 1 BKatV, Rn. 1). Von diesem kann das Gericht bei Vorliegen von Besonderheiten nach oben oder unten abweichen. Vorliegend bestehen keine Umstände, die ein Abweichen vom Regelsatz nach unten bedingen würden. Angesichts der vorsätzlichen Begehensweise ist die Regelgeldbuße auf 960 EUR zu verdoppeln, § 3 Abs. 4a BKatV.
Zudem sind hier Umstände gegeben, die eine Erhöhung der Geldbuße nach sich ziehen, § 17 Abs. 3 OWiG. Der Betroffene ist, wie unter I. festgestellt, bereits verkehrsrechtlich in Erscheinung getreten. Der zeitliche und auch inhaltliche Zusammenhang der geahndeten Verstöße mit der jetzigen Handlung gebietet eine moderate Erhöhung der Regelgeldbuße um 100 EUR (Abstand) sowie 100 EUR (Geräteverstoß) auf 1160 EUR.
Die Feststellungen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen haben ergeben, dass der Betroffene die ausgeurteilte Geldbuße wirtschaftlich verkraftet.
Des Weiteren ist vorliegend auch ein Regelfahrverbot anzuordnen, § 4 Abs. 1 BKatV. Durch die oben festgestellte Handlung hat der Betroffene eine objektiv so gefährliche und subjektiv so vorwerfbare Verhaltensweise im Straßenverkehr an den Tag gelegt, dass im Sinne des § 25 StVG ein Fahrverbot anzuordnen ist. Es bestand vorliegend kein Grund, wegen abweichender Umstände vom Regelfall das Fahrverbot zu erhöhen. Vorliegend bestand kein Grund, vom Wegfall des Fahrverbots ausgehen zu müssen. Soweit der Betroffene vorgetragen hat, seinen Arbeitsplatz zu verlieren und für die Berufstätigkeit auf die Fahrerlaubnis angewiesen zu sein, führt dies zu keiner anderen Bewertung. Insbesondere trifft die Anordnung des Fahrverbots den Betroffenen nicht mit einer unzumutbaren Härte. Gewöhnliche Belastungen, die ein Verzicht auf den PKW für die Dauer des Fahrverbots mit sich bringt, sind hinzunehmen. Die Konsequenz der Anordnung des Fahrverbots ist selbstverschuldet (OLG Celle Beschl. v. 26.1.2015 – 321 SsBs 176, 177/14, BeckRS 2015, 16403). Die Gleichbehandlung mit anderen Verkehrsteilnehmern, die ein Regelfahrverbot verwirkt haben, muss gewährleistet sein (BVerfG NZV 1996, 284), sodass nur unzumutbare Härten aus rechtlicher Sicht relevant sein können, nicht das persönliche Befinden des Betroffenen (BeckOK StVR/Krenberger, § 25 StVG, Rn. 90). Solche sind hier nicht gegeben. Zwar kann der Verlust des Arbeitsplatzes eine unzumutbare Härte darstellen. Ausweichmöglichkeiten im Betrieb sind, so der Zeuge pp., nicht gegeben und auch eine unbezahlte Urlaubnahme kann angesichts der Spezialisierung des Betroffenen vom Unternehmen nicht aufgefangen werden. Der Betroffene befindet sich noch in der Probezeit und kann deshalb unter erleichterten Bedingungen gekündigt werden. Jedoch ist hier zu beachten: Zum einen stammt der Bußgeldbescheid vom 16.8.2023, sodass der Betroffene das Fahrverbot noch vor Antritt der Arbeitsstelle bei der Firma pp. sozialkonform hätte ableisten können, wozu er auch verpflichtet gewesen wäre (OLG Hamm NZV 2005, 495; AG Landstuhl DAR 2015, 415). Er hätte, wenn es ihm nur um die Geldbußenhöhe und den Schuldvorwurf gegangen wäre, den Einspruch auf die Höhe der Geldbuße bei gleichzeitiger Akzeptanz des Fahrverbots beschränken können (AG Dortmund NZV 2022, 540), um den neuen Arbeitsplatz nicht zu gefährden. Und schließlich kann der Grundsatz der Unverhältnismäßigkeit nicht für den Betroffenen streiten, der in Kenntnis der Notwendigkeit der Fahrerlaubnis und des Führerscheins für seine Berufstätigkeit durch verkehrswidriges Verhalten seine Berufstätigkeit gefährdet: Ein Kraftfahrzeugführer, der ein Fahrverbot durch mangelnde Verkehrsdisziplin riskiert, kann nicht geltend machen, auf den Führerschein angewiesen zu sein (KG SVR 2015, 427). Könnte sich ein Betroffener bei vorhandenen Vorahndungen immer wieder aufs Neue auf eine drohende Existenzgefährdung berufen, wären die für ihn unzumutbaren Folgen eines Fahrverbots ein Freibrief für wiederholtes Fehlverhalten (OLG Frankfurt a. M. BeckRS 2010, 26343; OLG Karlsruhe NZV 2004, 316). Hinzu kommt hier der Vorsatz des Vorwurfs bei erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung im Baustellenbereich (AG Zeitz BeckRS 2015, 18698). Schließlich müsste der Arbeitsplatzverlust auch zu einer existenzvernichtenden Härte führen (OLG Karlsruhe NZV 2006, 326). Dies ist nicht erkennbar. Denn der Betroffene ist als Bauleiter mit Asbestberechtigung hoch spezialisiert und dementsprechend begehrt auf dem Arbeitsmarkt, so der Zeuge pp. Wenn er also eine vorübergehende Zeit, in der er auch Anspruch auf staatliche Leistungen hat, nicht im Abhängigkeitsverhältnis beschäftigt ist, vernichtet dies nicht seine bürgerliche Existenz.“
Ok, ein „viel beschossener Hase“. Aber dennoch erscheint mir die Entscheidung angesichts der für den Betroffenen sprechenden Umstände nicht angemessen, zumal die Trunkenheitsfahrt 10 Jahre zurück liegt. Dass und warum ein Betroffener verpflichtet sein soll, ein Fahrverbot ggf. noch vor Antritt der Arbeitsstelle bei seiner Firma „sozialkonform“ – was immer das auch ist – abzuleisten, erschießt sich mir (auch) nicht. Denn dabei wird m.E. übersehen, dass der Betroffene ggf. noch nicht rechtskräftig verurteilt ist.