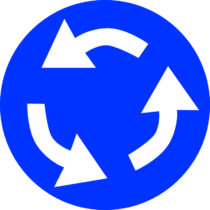Als zweite Entscheidung bringe ich dann heute den OLG München, Beschl. v.01.06.2017 – 1 AR 209/17 -1 AR 222/17. Es geht in dem Verfahren, in dem er ergangen ist, um die Bewilligung eines Vorschusses auf eine demnächst zu gewährende Pauschvergütung. Nun, in meinen Augen ist Pauschvergütung beim OLG München schwer, m.E. fast unmöglich. So auch in diesem Verfahren, in dem es wegen der Zuständigkeiten zunächst ein wenig hin und her gegangen ist. Der Kollege hatte den Antrag nämlich zunächst beim BGH gestellt. Grund: Er vertritt 15 Nebenklageberechtigte in dem Ermittlungsverfahren des GBA wegen des „Oktoberfestattentats“ vom 26.09.1980, bei dem dreizehn Menschen ermordet und über 200 verletzt wurden. Der Kollege ist mit Beschlüssen der Ermittlungsrichterin beim BGH vom 8.9.2016 als Verletztenbeistand beigeordnet (§§ 406g Abs. 1. Abs. 3 S, 1 Nr. 1 StPO (a.F.), 397a Abs. 1 StPO). Für die Entscheidung über den Antrag des Kollegen hatte sich die Ermittlungsrichterin des Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 08.06.2016 für nicht zuständig erklärt (vgl. BGH, Beschl. v. 08.06.2016 – 3 BGs 197/16).
Vorschuss gibt es – natürlich – nicht:
2. Der somit (nur) in Betracht kommende Vorschuss setzt nach dem Wortlaut des § 51 Abs. 1 S. 5 RVG voraus, dass dem Rechtsanwalt „insbesondere wegen der langen Dauer des Verfahrens und der Höhe der zu erwartenden Pauschgebühr nicht zugemutet werden kann, die Festsetzung der Pauschgebühr abzuwarten“ (Hervorh OLG). Daran fehlt es.
a) Vorliegend ist der Antragsteiler seit knapp 35 Jahren für Geschädigte des Oktoberfestattentats tätig, Für seine Tätigkeit im vorliegenden Verfahren wurde er im Jahre 2008 – mithin vor 9 Jahren ¬(erneut) mandatiert. Nach eigenen Angaben hat er für seine Tätigkeit während des gesamten Zeitraumes keine Zahlungen erhalten. Bereits aus diesem Grund erscheint es für ihn nicht unzumutbar, die – nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens allerdings naheliegende – Festsetzung einer Pauschgebühr abzuwarten.
b) Ein Vorschuss ist ein Ausgleich dafür, dass der Pflichtverteidiger, während er das Pflichtverteidigermandat bearbeiten muss, keine oder nur unbedeutende Umsätze erzielen kann (zit. BVerfG. B. vom 01. Juni 2011 — 1 BvR 3171/10 — dort Rn. 37., juris) und dadurch in eine wirtschaftlich existenzgefährdende Lage gerät. Der Staat darf den hoheitlich in Anspruch genommenen Pflichtverteidiger nicht sehenden Auges in eine existenzgefährdende Situation bringen, indem er ihm den Vorschuss auf die mit Sicherheit zu erwartende Pauschvergütung vorenthält und ihn auf eigene Anstrengungen zur Beseitigung der Existenzgefährdung verweist (eilt. BVerfG a.a.O. Rn_ 39). Der Senat hält daher – unabhängig davon, ob eine reale ,Existenzgefährdung“ verlangt werden kann – jedenfalls Angaben des Antragstellers zu erheblichen Einschränkungen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit. als Rechtsanwalt, die er durch die Ausübung seines Pflichtmandats erlitten hat. für geboten Trotz eines entsprechenden Hinweises an den Antragsteller vom 08.02.2017 fehlt es daran vorliegend jedoch vollständig. Aus den vom Antragsteller vorgetragenen und glaubhaft gemachten bisherigen Tätigkeiten (mindestens 880 Stunden, entsprechend 110 Arbeitstage in 34 Jahren) ergibt sich jedenfalls keine Belastung, die ihn währenddessen an der Übernehme und Bearbeitung anderer Mandate nachhaltig und auf Dauer gehindert hätte.
c) Auch die Höhe des beantragten hohen Vorschusses geht im Übrigen fehl, da dieser die letztlich zu erwartende Pauschgebühr nicht überschreiten darf.
Eine solche ist zwar angesichts des exorbitanten Umfanges des überaus bedeutsamen Verfahrens und des glaubhaft gemachten, hohen Aufwandes des Antragstellers zu erwarten. Eine Pauschgebühr wird wegen der Vorschrift des § 42 Abs. 1 S. 4 RVG jedoch in der Regel das Doppelte der denn Wahlbeistand zustehenden Höchstgebühren nicht überschreiten können. Der Senat ist der Auffassung, dass die gesetzlich vorgesehene Höchstgrenze einer Pauschgebührenfestsetzung für Wahlverteidiger – nämlich eine Verdoppelung der Höchstgebühren – für Pflichtverteidiger (und -beistände) grundsätzlich nicht überschritten werden kann. Immerhin ist die Bestellung zum Pflichtverteidiger eine besondere Form der Indienstnahme Privater zu öffentlichen Zwecken. Dass der Vergütungsanspruch des Pflichtverteidigers unter den Rahmengebühren des Wahlverteidigers liegt, ist durch einen gemeinwohlorientierten Interessenausgleich gerechtfertigt, sofern die Grenze der Zumutbarkeit für den Pflichtverteidiger gewahrt ist. (vgl BVerfG, 06.11.198.2 BvL 16183, BVerfGE 68, 237 <253 ff>, Hervorh. OLG). Daraus folgt nach Auffassung des Senats, dass der Pflichtverteidiger und der bestellte Beistand jedenfalls nicht besser als Wahlverteidiger und Wahlbeistände gestellt werden können. Hierbei verkennt der Senat nicht, dass Wahlverteidiger (anders als Pflichtverteidiger) gem. § 3a RVG eine höhere Vergütung vereinbaren können (Burhoff in Gerold/Schmitt, Komm. zum RVG, 22. Aufl., Rn. 41 zu § 51 m.w.N.), bei außergewöhnlich umfangreichen Verfahren auch vereinbaren werden und notfalls ein wirtschaftlich unzumutbares Wahlmandat beenden können. Vorliegend hat der Antragsteller jedoch – obwohl er vor seiner erst im Jahr 2016 erfolgten Bestellung über Jahrzehnte für eine Vielzahl von Mandanten tätig war – von einer solchen Vergütungsvereinbarung abgesehen und damit zu erkennen gegeben, dass ihm – jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt – die durch § 42 Abs. 1 S. 4 RVG beschränkten Maximalgebühren ausreichten.“
Zumindest wegen der Begrenzung der Pauschgebühr auf das Doppelte der Wahlanwaltshöchstgebühren in meinen Augen falsch. Andere OLG machen das auch anders. Aber die erwähnt man lieber erst gar nicht.