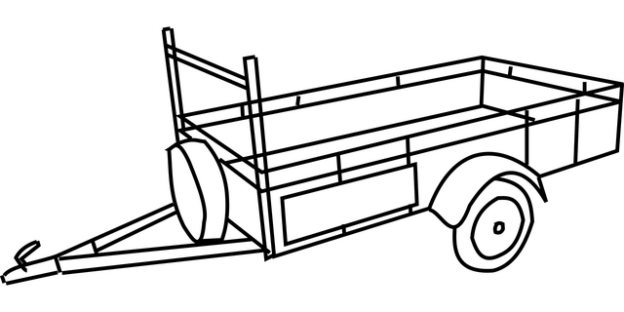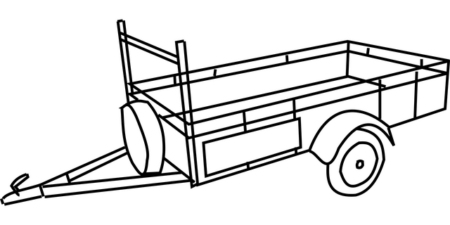Heute befinden sich dann im „Kessel Buntes“ zwei verkehrszivilrechtliche Entscheidungen, und zwar zunächst das BGH, Urt. v. 07.02.2023 – VI ZR 87/22 – zur Reichweite der Haftung des Halters eines Anhängers nach § 7 Abs. 1 StVG a.F. bzw. § 19 Abs. 1 Satz 1 StVG n.F.
Entschieden hat der BGH über die Klage eines Gebäudeversicherers. Der hat vom Haftpflichtversicherer eines Anhängers aus übergegangenem Recht Schadenersatz aufgrund eines Unfalls verlang, Der Anhänger war ordnungsgemäß auf einer Straße abgestellt worden. Auf dieser Straße ist ein Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dabei gegen ein Gebäude und den Anhänger gestoßen. Durch den Aufprall rollte der Anhänger nach vorn und stieß gegen das bei der Klägerin versicherte Nachbargebäude, das teilweise beschädigt wurde. Die Gebäudeversicherung erstattete dem Eigentümer die für die Beseitigung der Schäden entstandenen Kosten. Die verlangt er nun ersetzt.
Das AG hatte der Klage stattgegeben. Das LG hatte sie abgewiesen. Die Revision der Klägerin hatte Erfolg:
„….Diese Erwägungen halten der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts sind die Anspruchsvoraussetzungen des § 7 Abs. 1 StVG a.F. zu bejahen. Die Beschädigung des bei der Klägerin versicherten Gebäudes ist beim Betrieb des bei der Beklagten versicherten Anhängers eingetreten.
1. Voraussetzung der Haftung nach § 7 Abs. 1 StVG in der bis 16. Juli 2020 geltenden Fassung (vgl. nunmehr § 19 Abs. 1 Satz 1 StVG ) ist, dass bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers, der dazu bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, eines der in der Vorschrift genannten Rechtsgüter verletzt bzw. geschädigt worden ist.
a) Wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt zu Recht angenommen hat, ist das Haftungsmerkmal „bei dem Betrieb“ in Bezug auf Kraftfahrzeuge entsprechend dem umfassenden Schutzzweck der Norm weit auszulegen. Denn die Haftung nach § 7 Abs. 1 StVG ist der Preis dafür, dass durch die Verwendung eines Kraftfahrzeugs erlaubterweise eine Gefahrenquelle eröffnet wird; die Vorschrift will daher alle durch den Kraftfahrzeugverkehr beeinflussten Schadensabläufe erfassen. Ein Schaden ist demgemäß bereits dann „bei dem Betrieb“ eines Kraftfahrzeugs entstanden, wenn sich in ihm die von dem Kraftfahrzeug ausgehenden Gefahren ausgewirkt haben, d.h. wenn bei der insoweit gebotenen wertenden Betrachtung das Schadensgeschehen durch das Kraftfahrzeug (mit)geprägt worden ist (vgl. Senatsurteil vom 11. Februar 2020 – VI ZR 286/19 ,VersR 2020, 782Rn. 10 mwN).
Erforderlich ist dabei stets, dass es sich bei dem Schaden, für den Ersatz verlangt wird, um eine Auswirkung derjenigen Gefahren handelt, hinsichtlich derer der Verkehr nach dem Sinn der Haftungsvorschrift schadlos gehalten werden soll; die Schadensfolge muss in den Bereich der Gefahren fallen, um derentwillen die Rechtsnorm erlassen worden ist. Für die Zurechnung der Betriebsgefahr kommt es damit grundsätzlich maßgeblich darauf an, dass die Schadensursache in einem nahen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit einem bestimmten Betriebsvorgang oder einer bestimmten Betriebseinrichtung des Kraftfahrzeugs steht (vgl. Senatsurteile vom 3. Juli 1962 – VI ZR 184/61 , BGHZ 37, 311 , juris Rn. 12 ff.; vom 11. Februar 2020 – VI ZR 286/19 ,VersR 2020, 782Rn. 10; vom 20. Oktober 2020 – VI ZR 319/18 ,VersR 2021, 597Rn. 7, jeweils mwN). Der Betrieb dauert dabei fort, solange der Fahrer das Fahrzeug im Verkehr belässt und die dadurch geschaffene Gefahrenlage fortbesteht (vgl. Senatsurteil vom 11. Februar 2020 – VI ZR 286/19 ,VersR 2020, 782Rn. 10 mwN).
b) Diese Grundsätze sind entsprechend auf den Betrieb von Anhängern anzuwenden, die dazu bestimmt sind, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden (vgl. Senatsurteil vom 11. Februar 2020 – VI ZR 286/19 ,VersR 2020, 782Rn. 11 mwN).
2. Nach diesen Grundsätzen ist der im Streitfall eingetretene Gebäudeschaden beim Betrieb des bei der Beklagten versicherten und zum Mitführen durch ein Kraftfahrzeug bestimmten Anhängers eingetreten. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts haben sich in dem Schadensgeschehen die von dem Anhänger ausgehenden Gefahren ausgewirkt. Auch wenn der Fahrer des Pkw, der die Kontrolle über das von ihm geführte Fahrzeug verloren hatte, den Unfallablauf maßgeblich bestimmt haben mag, ist das Schadensgeschehen bei der insoweit gebotenen wertenden Betrachtung durch den Anhänger (mit)geprägt worden und auch seinem Betrieb zuzurechnen.
a) Der streitgegenständliche Schaden ist dadurch verursacht worden, dass der auf der Straße abgestellte und infolge eines Anstoßes durch ein Drittfahrzeug ins Rollen geratene Anhänger gegen das Gebäude mit der Hausnummer XXX geprallt ist. In dem Geschehen hat sich die aus der Konstruktion des Anhängers resultierende Gefahr einer unkontrollierten Bewegung durch Einwirkung von Fremdkraft verwirklicht, die durch das Abstellen des Anhängers im öffentlichen Verkehrsraum noch nicht beseitigt war. Diese Gefahr wird nach den oben dargestellten Grundsätzen vom Schutzzweck des § 7 Abs. 1 StVG a.F. bzw. § 19 Abs. 1 Satz 1 StVG n.F. erfasst (vgl. Senatsurteil vom 11. Februar 2020 – VI ZR 286/19 ,VersR 2020, 782Rn. 19).
b) Eine Zurechnung des entstandenen Gebäudeschadens zum Betrieb des bei der Beklagten versicherten Anhängers ist entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht deshalb zu verneinen, weil der Fahrer des Pkw, der die Kontrolle über das von ihm geführte Fahrzeug verloren hatte, das Unfallgeschehen maßgeblich bestimmt habe. Diesem Umstand kann bei der Abwägung der Verursachungs- und Verschuldensbeiträge im Rahmen eines etwaigen Gesamtschuldnerinnenausgleichs der Schädiger gemäß § 426 Abs. 1 , § 254 Abs. 1 BGB Bedeutung zukommen (vgl. Senatsurteil vom 10. Februar 2004 – VI ZR 218/03 ,VersR 2004, 529, juris Rn. 19 f. zur Abwägung gemäß § 17 StVG ; Senatsurteil vom 6. Dezember 2022 – VI ZR 284/19 , juris Rn. 23). Er rechtfertigt aber nicht die Annahme, dass es an dem im Rahmen der Gefährdungshaftung erforderlichen Zurechnungszusammenhang zwischen dem eingetretenen Gebäudeschaden und dem Betrieb des Anhängers fehle. Anders als das Berufungsgericht meint, hat sich insoweit insbesondere nicht ein gegenüber der Betriebsgefahr eigenständiger Gefahrenkreis verwirklicht (vgl. dazu Senatsurteil vom 2. Juli 1991 – VI ZR 6/91 , BGHZ 115, 84 , juris Rn. 11). Der Gebäudeschaden steht bei wertender Betrachtung auch nicht in einem nur „äußerlichen“, gleichsam „zufälligen“ Zusammenhang mit der von dem Anhänger ausgehenden Gefahr (vgl. dazu Senatsurteile vom 26. März 2019 – VI ZR 236/18 ,VersR 2019, 897Rn. 12; vom 27. November 2007 – VI ZR 210/06 ,VersR 2008, 656Rn. 12). Vielmehr wirkt in dem Gebäudeschaden die dem Anhänger konstruktionsbedingt innewohnende und durch sein Belassen im Verkehrsraum aufrechterhaltene Gefahr einer unkontrollierten Bewegung durch Einwirkung von Fremdkraft fort. Wird ein im Verkehrsraum abgestellter Anhänger infolge eines Anstoßes durch ein Drittfahrzeug in Bewegung versetzt und beschädigt im Rollvorgang ein Gebäude, verwirklicht sich eine typische Gefahrenquelle des Straßenverkehrs, die bei wertender Betrachtung vom Schutzzweck des § 7 Abs. 1 StVG a.F. bzw. § 19 Abs. 1 Satz 1 StVG n.F. erfasst wird. In diesem Fall ist die Schädigung eine spezifische Auswirkung derjenigen Gefahren, für die die Haftungsvorschrift den Verkehr schadlos halten will.
c) Die Haftung der Beklagten kann schließlich auch nicht, wie die Revisionserwiderung geltend macht, mit der Erwägung verneint werden, der im Streitfall eingetretene Schaden hätte in gleicher Weise durch einen an derselben Stelle befindlichen Müllcontainer mit Rollen verursacht werden können. Die Bestimmungen in § 7 Abs. 1 StVG a.F. und § 19 Abs. 1 Satz 1 StVG n.F. beschränken die Einstandspflicht des Halters nicht auf fahrzeugspezifische Gefahren in dem Sinne, dass sie nur Schäden erfassten, die allein durch ein Fahrzeug bzw. einen zum Mitführen durch ein Kraftfahrzeug bestimmten Anhänger verursacht werden können (vgl. Senatsurteil vom 11. Februar 2020 – VI ZR 286/19 ,VersR 2020, 782Rn. 23 mwN).“