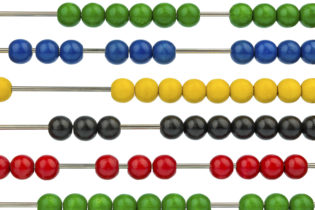In der zweiten Entscheidung des Tage, dem BGH, Beschl. v. 30.03.2021 – VIII ZB 37/19 – geht es mal wieder um Anwaltsverschulden, also: Wiedereinsetzungsproblematik.
Entscheiden musste der BGH die Frage der Wiedereinsetzung gegen eine verspätete Berufung gegen ein Urteil des LG Köln. Das Urteil war am 10.12.2018 zugestellt. Gegen das Urteil hatte die Beklagte mit Schriftsatz vom 10.01. 2019 am selben Tag Berufung eingelegt. Die Berufungsschrift war an das OLG Köln gerichtet, jedoch mit der Telefaxnummer des Landgerichts Köln versehen. Dieses leitete die Berufungsschrift an das OLG Köln weiter, wo sie am 11.01.2019 einging. Zur Begründung ihres (rechtzeitig gestellten) Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Berufungsfrist hat die Beklagte im Wesentlichen vorgetragen:
„In der Kanzlei ihrer Prozessbevollmächtigten werde seit dem Jahr 2016 das Kanzlei-Management-System „K. “ verwendet. Dabei würden die Stammdaten der Gerichte unmittelbar durch Zugriff auf eine vom Systemanbieter zur Verfügung gestellte Datenbank generiert. Bei der Erstellung eines Schriftstücks füge das System automatisch – nachdem das betreffende Gericht durch Anklicken ausgewählt worden sei – im Adressfeld unter anderem dessen Telefaxnummer ein.
Zur Einhaltung von Fristen bestünden in der Kanzlei ihrer Prozessbevollmächtigten bereits vor und auch nach Einführung des Systems „K. “ Anweisungen, die der hier tätig gewordenen Kanzleiangestellten P. , die die Berufungsschrift per Telefax versandt habe, bekannt gewesen seien. Werde ein Schriftsatz per Telefax versandt, sei zuvor zu prüfen, ob der korrekte Adressat eingesetzt worden sei, ebenso die zutreffende Anschrift sowie die richtige Telefaxnummer des Empfängers. Dies habe anhand einer verlässlichen Quelle zu geschehen. Handele es sich um einen bestehenden Vorgang, sei ein Abgleich mit den Daten im jüngsten Schreiben des Adressaten, etwa des Gerichts, in der Akte vorzunehmen. Bei einem neuen Vorgang sei ein Datenabgleich mit der Internetseite des Gerichts erforderlich. Nach der Versendung des Telefaxes sei ein Abgleich zwischen der auf dem Sendeprotokoll ausgewiesenen Faxnummer mit derjenigen auf dem versandten Schriftstück vorzunehmen.
Am Morgen des 10. Januar 2019 habe die – als zuverlässig, sorgfältig und vertrauenswürdig bekannte – Kanzleiangestellte P. , die mehr als zehn Jahre Assistentin der Prozessbevollmächtigten der Beklagten sei, ohne dass es in dieser Zeit einen Vorfall gegeben habe, der zu einer Fristversäumnis geführt habe, die Berufungsschrift vorbereitet. Zur Veränderung des Außenauftritts der Kanzlei, unter anderem durch Verwendung eines neuen Logos und eines neuen Schriftbilds habe der Geschäftsführer der Kanzlei, Rechtsanwalt B. , zur Jahreswende 2018/2019 Formatvorlagen für Schriftsätze angepasst. Darüber seien alle Kanzleimitglieder per E-Mail vom 3. Januar 2019 unterrichtet worden. Eine Formatvorlage für eine Berufungsschrift habe am Morgen des 10. Januar 2019 noch nicht zur Verfügung gestanden. Auf Anfrage der Prozessbevollmächtigten der Beklagten und der Kanzleiangestellten P. habe Rechtsanwalt B. dazu die Auskunft erteilt, es sei entweder die Formatvorlage „Klage“ oder die Formatvorlage „Schriftsatz“ zu verwenden, weil deren Layout schon angepasst worden sei.
Frau P. habe nunmehr als Überschrift des Schriftsatzes „Berufung“ anstelle von „Klage“ eingetragen. Nach Eingabe des gesuchten Gerichts sei das Oberlandesgericht Köln als Empfänger der Berufungsschrift auf dem Bildschirm erschienen. Das System habe dessen Adresse eingefügt sowie die Zeile: „Vorab per Fax: +49 221 477-3333“. Diese Stammdaten seien in der vom Systemanbieter zur Verfügung gestellten Datenbank enthalten gewesen. Nach dem Ausdruck der Berufungsschrift habe die Prozessbevollmächtigte der Beklagten diese unterzeichnet, ohne zu bemerken, dass die Telefaxnummer des Landgerichts Köln, nicht aber diejenige des Oberlandesgerichts Köln angegeben gewesen sei. Frau P. habe den Schriftsatz sodann gefaxt, ohne zuvor die Angaben, insbesondere die Telefaxnummer, nochmals anhand der Internetseite des Oberlandesgerichts auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Nach dem Telefaxversand habe Frau P. die Faxnummer auf dem Schriftsatz mit derjenigen auf dem Faxprotokoll abgeglichen und festgestellt, dass diese identisch seien.
Das Einsetzen einer falschen Telefaxnummer durch das System „K. “ sei zuvor noch nie vorgekommen. Nachdem sich dies hier – durch ein Telefonat mit der Geschäftsstelle des Oberlandesgerichts – herausgestellt habe, sei der Vorgang testweise wiederholt worden. Erneut sei trotz Angabe des Oberlandesgerichts Köln die Telefaxnummer des Landgerichts Köln automatisch der Datenbank entnommen worden. Sodann sei als Empfangsgericht das Oberlandesgericht Hamburg angegeben worden; wiederum habe das System automatisch die Telefaxnummer des dortigen Landgerichts eingesetzt.
Rechtsanwalt B. habe sodann herausgefunden, dass in der verwendeten und hinterlegten Vorlage anstelle der korrekten Variable für die Telefaxnummer des Oberlandesgerichts eine Variable hinterlegt gewesen sei, die mit einem falschen Datenbankfeld verknüpft gewesen sei, nämlich mit der Telefaxnummer des Landgerichts. Wie und wann die fehlerbehaftete Variable Eingang in das System gefunden habe, sei derzeit nicht erklärbar. Anlässlich der Überarbeitungen zum Jahreswechsel 2018/2019 sei eine inhaltliche Anpassung der für den Adressblock verwendeten Variablen jedenfalls nicht erforderlich gewesen; die hinterlegten Daten seien bei der Änderung der Formatvorlagen unberührt geblieben. Diese hätten nur das Layout und den Aufbau der Word-Dokumente betroffen.“
Das OLG hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurückgewiesen und die Berufung als unzulässig verworfen. Dagegen die Rechtsbeschwerde zum BGH, die Erfolg hatte.
Hier der Leitsatz der BGH-Entscheidung, und zwar:
Ein Rechtsanwalt ist hinsichtlich der fristwahrenden Übermittlung von Schriftsätzen gehalten, durch geeignete organisatorische Vorkehrungen, insbesondere durch entsprechende allgemeine Anweisungen an das Büropersonal, sicherzustellen, dass Fehlerquellen im größtmöglichen Umfang ausgeschlossen sind und gewährleistet ist, dass – anhand einer nochmaligen Überprüfung der Faxnummer des angeschriebenen Gerichts entweder vor der Versendung oder mit dem Sendebericht anhand einer zuverlässigen Quelle – bei der Adressierung die zutreffende Faxnummer verwendet wird.
Im Übrigen meint der BGH, dass die generelle Büroanweisung, wonach die Telefaxnummer des Gerichts – unabhängig von der Kanzleisoftware – anhand einer zuverlässigen Quelle außerhalb der Datenbank des Kanzlei-Management-Systems zu überprüfen ist, den gebotenen Anforderungen an die anwaltliche Sorgfaltspflicht (noch) genügt.