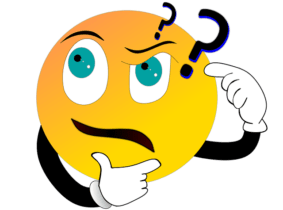entnommen wikimedia.org
Urheber User: High Contrast
Im Kessel Buntes ist heute zunächst der OLG Hamm, Beschl. v. 18.05.2017 – 2 U 39/17. Der passt ganz gut zu den Meldungen, die gestern betreffend Absprachen der Autobauer über die Ticker gelaufen sind.Wenn man es liest, meint man, es dann doch mit einer kriminellen Vereinigung zu tun zu haben 🙂 .
Im Beschluss geht es um die Rückabwicklung eines Kaufvertrages über einen Pkw, der vom sog. Abgasskandal betroffen war. Der klagende Käufer verlangt von der beklagten selbstständigen Automobilvertragshändlerin Rückerstattung des Kaufpreises abzüglich gezogener Nutzungen. Er hat den Kaufvertrag wegen arglistiger Täuschung angefochten. Es ist unstreitig, dass die Händlerin im Zeitpunkt des Vertragsschlusses von Manipulationen der Abgaswerte keine Kenntnis hatte. Der Kläger ist aber der Auffassung, dass sich die Beklagte die Täuschung über Stickoxidwerte durch den Fahrzeughersteller zurechnen lassen muss. Das LG Dortmund hatte die Klage abgewiesen. Das OLG Hamm hat im Hinweisbeschluss vom 18.05.2017 – 2 U 39/17 – auf die voraussichtliche Erfolglosigkeit der Berufung hingewiesen und diese dann im OLG Hamm, Beschl. v. 09.06.2017 – 2 U 39/17 – zurückgewiesen. Aus dem Beschluss vom 18.05.2017:
„Die im Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses unstreitig gutgläubige Beklagte hat den Kläger nicht gem. § 123 I BGB getäuscht. Eine etwaige Täuschungshandlung der B AG (Herstellerin) ist der Beklagten (Verkäuferin) unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zurechenbar. Vielmehr handelt es sich bei der B AG um einen “Dritten” i.S.d. § 123 II 1 BGB, ohne dass die Beklagte die etwaige Täuschung kannte oder kennen musste.
Die Beklagte ist eine eigenständige juristische Person und bloße Vertragshändlerin. Zwischen dem Hersteller und dem Verkäufer ist in rechtlicher Hinsicht zu unterscheiden. Daher entspricht es auch der gefestigten BGH-Rechtsprechung, dass der Hersteller nicht Erfüllungsgehilfe des Händlers ist (vgl. BGH NJW 2014, 2183, Tz. 31). Dementsprechend muss sich auch im Rahmen des § 123 BGB ein Automobilvertragshändler nicht das Wissen des Herstellers zurechnen lassen (vgl. OLG Celle, Beschluss vom 30.06.2016, 7 W 26/16, zitiert nach juris; LG Bamberg, Urteil vom 22.07.2016, 11 O 62/16, zitiert nach juris; LG Regensburg, Urteil vom 15.06.2016, 3 O 2161/15, zitiert nach juris; LG München II, Urteil vom 15.11.2016, 12 O 1482/16, zitiert nach juris; LG Hechingen, Urteil vom 10.03.2017, 1 O 165/16, zitiert nach juris; LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 21.06.2016, 4 O 441/16, zitiert nach juris; LG Landau (Pfalz), Urteil vom 11.07.2016, 2 O 17/16, zitiert nach juris; LG Düsseldorf, Urteil vom 23.08.2016, 6 O 413/15, zitiert nach juris; LG Frankenthal, Urteil vom 12.05.2016, 8 O 208/15, zitiert nach juris; LG Stralsund, Urteil vom 03.03.2016, 6 O 236/15, zitiert nach juris; LG Bielefeld, Urteil vom 02.05.2016, 3 O 318/15, zitiert nach juris).
Entgegen der Ansicht der Berufung kann von einem durchschnittlichen Fahrzeugkäufer erwartet werden, dass er zwischen einem Vertragshändler und dem Hersteller unterscheiden kann. Nach den vom Kläger vorgelegten Unterlagen hat die Beklagte auch nicht den Anschein erweckt, eine Werksniederlassung bzw. Konzerntochter der B AG zu sein. Dass ein selbstständiger Automobilvertragshändler in seinen Ausstellungsräumen Fahrzeuge der von ihm vertriebenen Marke präsentiert und das Firmen-Logo des Herstellers verwendet, entspricht – wie bereits das Landgericht zutreffend dargelegt hat – der Üblichkeit. In der Rechnung vom 03.01.14 (Anlage BB 1, Bl. 83 ff. d.A) ist zwar in der Kopfzeile die Bezeichnung “B Zentrum C” aufgeführt, jedoch finden sich in der Fußzeile die genaue Firmenbezeichnung der Beklagten mit den rechtlich relevanten Angaben. Auf dem vom Kläger vorgelegten Homepage-Ausdruck (Bl. 46 d.A.) dominiert in der Kopfzeile die Firma der Beklagten (“K”). Hieraus ist auch zu ersehen, dass die Beklagte nicht nur mit Automobilen der Marke B, sondern auch mit solchen der Marken Z1, Z2, Y und X handelt. Wenn der Kläger ernsthaft behaupten will, dass er sich beim Kauf des rund 60.000 EUR teuren Autos nicht darüber im Klaren gewesen sei, wer überhaupt sein Vertragspartner ist, so kann diese Unwissenheit nicht der Beklagten angelastet werden.
Ebenso wenig kann eine Wissenszurechnung über eine analoge Anwendung des § 166 II BGB begründet werden. Die Beklagte hat den Kaufvertrag im eigenen Namen und für eigene Rechnung abgeschlossen. Sie hatte keine “vertreterähnliche” Position und war auch nicht “Verhandlungsbevollmächtigte” der B AG; eine Situation, die mit einer Stellvertretung vergleichbar wäre, lag nicht vor. Insoweit passt auch die von der Berufung zitierte, einen Grundstückskaufvertrag betreffende Entscheidung des OLG Köln (Urteil vom 24.03.1993, 2 U 160/92, zitiert nach juris) auf den vorliegenden Fall nicht. Die Argumentation der Berufung, dass sich nach dem Rechtsgedanken des § 166 II BGB der Vertretene nicht hinter der Unkenntnis seines Vertreters verstecken dürfe und dass sich dementsprechend auch die B AG nicht hinter ihrer Vertragshändlerin, der Beklagten, verstecken dürfe, geht fehl. Denn der Kläger nimmt nicht die B AG, sondern die unstreitig gutgläubige Beklagte in Anspruch. Eine Eigenhaftung des gutgläubigen Vertreters sieht § 166 II BGB aber gerade nicht vor.“
Allmählich kommen also die Verfahren bei den Obergerichten an….. Und irgendwann werden wir auch vom BGH etwas hören….