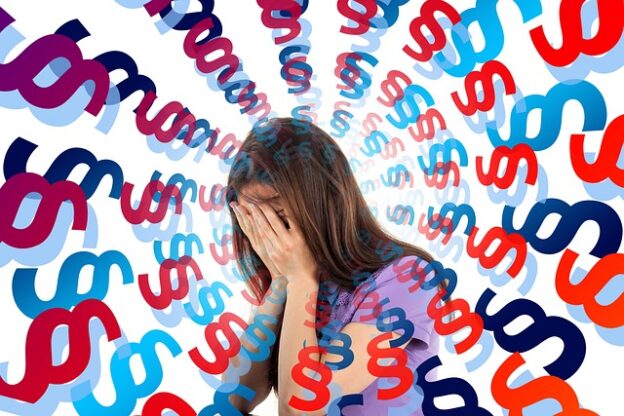So, und heute dann Strafzumessungsentscheidungen. Es ist ein bisschen mehr als sonst, da sich einiges angesammelt hat. Hier zunächst einige BGH-Entscheidungen, allerdings nur mit „Leitsätzen“. Den Rest bitte selbst nachlesen. Hier kommen dann:
Auch im Anwendungsbereich des § 47 Abs. 2 Satz 1, Abs. 1 StGB muss die Strafe einen gerechten Schuldausgleich für das begangene Tatunrecht nach Maßgabe der Schwere der Tat und des Grads der persönlichen Schuld des Täters darstellen muss. Deshalb legen ggf. die bisherige Unbestraftheit der Angeklagten, das Gewicht ihrer Tathandlung sowie – bei einem BtM-Delikt – die Überschreitung der Grenze zur nicht geringen Menge des Wirkstoffgehalts THC (allein) um das 1,6-fache eine vertiefte Erörterung nahe, weshalb eine Geldstrafe (§ 47 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 StGB) das Vertrauen der Bevölkerung in die Unverbrüchlichkeit des Rechts ernsthaft beeinträchtigen würde.
Wird ein Urteil auf ein Rechtsmittel zugunsten eines Angeklagten im Strafausspruch aufgehoben und vermag der neue Tatrichter Feststellungen nicht zu treffen, die im ersten Rechtszug als bestimmende Zumessungstatsachen strafschärfend herangezogen worden waren, hält er aber dennoch eine gleich hohe Strafe für erforderlich, so hat er nach ständiger Rechtsprechung seine Entscheidung eingehend zu begründen. Die ursprüngliche Bewertung der Tat und die Strafzumessung in der aufgehobenen Entscheidung sind zwar kein Maßstab für die neue Bemessung der Strafe, jedoch hat der Angeklagte einen Anspruch darauf zu erfahren, warum sie trotz des Wegfalls eines Strafschärfungsgrundes nun gleich hoch bestraft wird.
Allein eine polizeiliche Überwachung stellt keinen Strafmilderungsgrund dart, auch nicht unter dem Gesichtspunkt, dass die Straftat hätte verhindert werden können; ein Straftäter hat keinen Anspruch darauf, dass die Ermittlungsbehörden rechtzeitig gegen ihn einschreiten, um seine Taten zu verhindern. Es kann indes einen über die Sicherstellung hinausgehenden Strafmilderungsgrund darstellen, wenn die polizeiliche Überwachung der Tat mit dem Wegfall einer Gefahr für Rechtsgüter des Tatopfers verbunden ist. Dieses Gewicht resultiert aus dem Gewinn an Sicherheit, den eine derartige Überwachung schon während der Tatbegehung bewirkt, indem sie bereits von Beginn an die Möglichkeit für eine spätere Sicherstellung schafft und so eine tatsächliche Gefahr für die betroffenen Rechtsgüter ausschließt; insoweit reduziert sie das Handlungsunrecht zusätzlich gegenüber Fällen, in denen eine Sicherstellung trotz fehlender Überwachung letztlich gelingt.
Die erfolgte Sicherstellung der zum Eigenkonsum bestimmten Betäubungsmittel stellt einen bestimmenden Strafzumessungsgrund zugunsten des Angeklagten dar. Entfällt durch die Sicherstellung die auch beim Besitz von Betäubungsmitteln stets bestehende abstrakte Gefahr für die Allgemeinheit durch eine Weitergabe, ist dies ebenso wie beim Handeltreiben mit Betäubungsmitteln regelmäßig zugunsten des Angeklagten zu berücksichtigen.
Das Vorliegen insbesondere einschlägiger Vorstrafen stellt einen Strafschärfungsgrund dar. Umgekehrt vermag das Fehlen von Strafschärfungsgründen regelmäßig eine Strafmilderung nicht zu begründen.