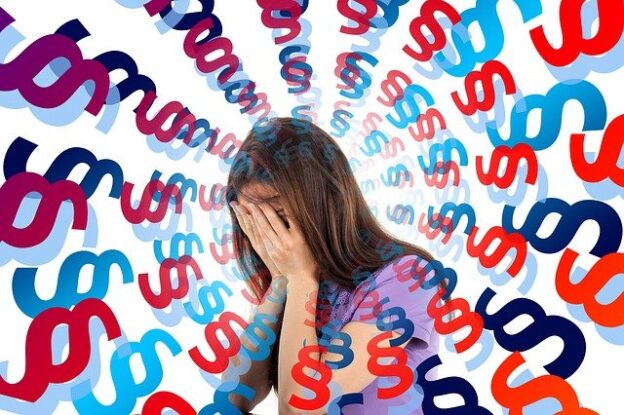nd dann zum Schluss des Tages noch der LG Zweibrücken, Beschl. v. 23.08.2023 – 2 StVK 241/23 Vollz. Der Beschluss ist schon etwas älter, heute „passt2 er aber.
Es geht in der Entscheidung um den Widerruf von Vollzugslockerungen als Disziplinarmaßnahme. Das LG hat den als rechtwidrig angesehen:
„…..
Letztlich kommt es darauf nicht an, denn die Antragsgegnerin hat es zunächst versäumt, die Vorschrift des § 101 Abs. 4 LJVollzG zu prüfen, wonach begünstigende Maßnahmen – und um eine solche begünstigende Maßnahme handelt es sich bei der Gewährung von Vollzuglockerungennur aufgehoben werden dürfen, wenn die vollzuglichen Interessen an der Aufhebung in Abwägung mit dem schutzwürdigen Vertrauen der Betroffenen auf den Bestand der Maßnahmen überwiegen. Die insoweit vom Gesetz geforderte Interessenabwägung hat die Antragsgegnerin nicht vorgenommen – jedenfalls findet sich hierzu nichts in der angegriffenen Verfügung-.
Das Gericht hat darüber hinaus jedoch nach § 115 Abs. 5 StVollzG, soweit die Vollzugsbehörde ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen zu handeln, auch zu prüfen, ob die Maßnahme oder ihre Ablehnung oder Unterlassung rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht ist. Bei dem Widerruf nach § 101 Abs. 3 LJVollzG handelt es sich um eine Ermessensentscheidung, was bereits der Wortlaut der Vorschrift (begünstigende Maßnahmen „können“ widerrufen werden) klarstellt. Ausweislich der angegriffenen Verfügung hat die Antragsgegnerin aber von dem ihr zustehenden Ermessen hinsichtlich des Widerrufs keinerlei Gebrauch gemacht. So führt die Antragsgegnerin, nachdem sie kurz festhält, warum die materiellrechtlichen Voraussetzungen eines Widerrufs gegeben seien, lediglich aus, dass die Lockerungen nach § 101 Abs. 3 Nr. 1 LJVollzG widerrufen werden. Die Annahme ist gerechtfertigt, dass sich die Antragsgegnerin des ihr zustehende Ermessen bei der Entscheidung über den Widerruf nicht bewusst war und sie dieses deshalb nicht ausgeübt hat. Insoweit liegt ein Fall des Ermessensnichtgebrauchs als Unterfall eines beachtlichen Ermessensfehlers auf Seiten der Antragsgegnerin vor, zu dessen Prüfung die Kammer nach § 115 Abs. 5 StVollzG veranlasst ist. Es finden sich in der angegriffenen Verfügung keinerlei erforderliche Ausführungen zum Gebrauch des der Antragsgegnerin zustehenden Ermessens. Dies gilt umso mehr, als dass in die anzustellenden Ermessenserwägungen wiederum die in die Abwägung nach § 101 Abs. 4 LJVollzG einzustellenden Umstände einzufließen haben, welche die Antragsgegnerin wie ausgeführt gänzlich nicht behandelt hat.
Die Antragsgegnerin hat zwischenzeitlich im gerichtlichen Verfahren zwar ihre Rechtsaulfassung deutlich gemacht, dass § 101 Abs. 4 LJVollzG bei der Prüfung des Widerrufs der Lockerungseignung zu beachten ist und dazu im Fall des Antragstellers näher begründet, warum der Vorfall veranschaulicht, dass eine notwendige Absprachefähigkeit, welche für die Gewährung von Vollzugslockerungen erforderlich ist, aus ihrer Sicht noch nicht in ausreichendem Maße gegeben ist (BI. 47-48 d.A.).
Die Ermessensentscheidung muss jedoch zum Zeitpunkt des Erlass der Entscheidung ausreichend begründet werden. Es besteht daher nicht nur eine Aufklärungsverpflichtung, sondern auch eine Begründungspflicht, die Grundlagen der Entscheidung sind im Einzelnen wiederzugeben. Genügt die Begründung den Anforderungen nicht, kann sie weder durch ergänzenden Vortrag der Vollzugsbehörde im gerichtlichen Verfahren, noch durch eigene Ermittlungen der Strafvollstreckungskammer ersetzt werden (OLG Zweibrücken, Beschluss vom 12.05.2017 -1 Ws 235/16 Vollz, Rn. 17; KG, Beschluss vom 27.02.2014 – 2 Ws 55/14 Vollz, Rn. 25; OLG Hamburg, Beschluss vom 09.01.2020 – 5 Ws 61/19 Vollz, Ls. 2). Teilt die Antragsgegnerin mit, das ggf. Vorliegen von vorherigen Hausordnungsverstößen fließe grundsätzlich immer im Rahmen des Ermessens mit in die Entscheidung ein, die Tatsache, dass dies nicht verschriftet wurde kein,Beleg für ein unzulässiges Nachschieben von Gründen sei, trifft dies bei der Kammer nicht auf Zustimmung. Etwas anderes könnte vielleicht dann gelten, wenn es im konkreten Fall lediglich darum ginge, eine gedanklich bereits existierende, lediglich aus Zeitgründen nicht schriftlich ausgeführte Begründung nachträglich zu fixieren (KG, a.a.O). So liegt der Fall hier jedoch nicht. Es ist aus Sicht der Kammer, wie bereits dargelegt, nun nicht mehr nachvollziehbar, ob sich die Antragstellerin zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerruf der Lockerungseignung bewusst gewesen ist, dass ihr ein Ermessensspielraum zukommt und welche Gesichtspunkte maßgeblich waren. Dies darf sich nicht zum Nachteil der Antragstellerin auswirken (KG, a.a.O.).“