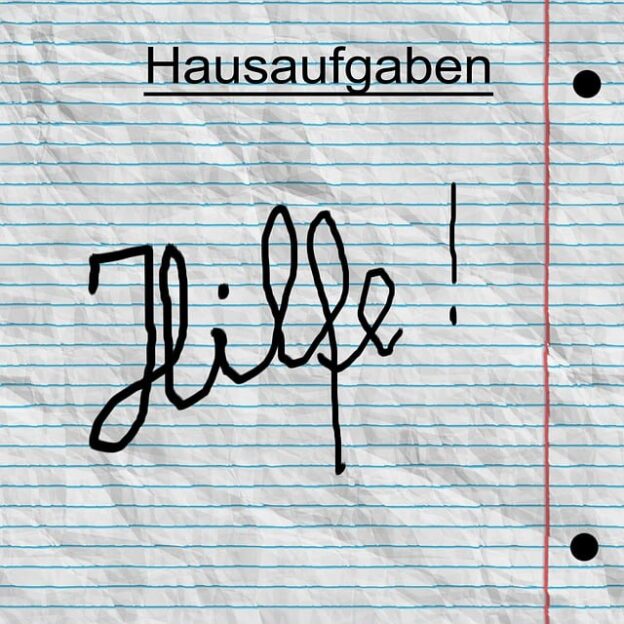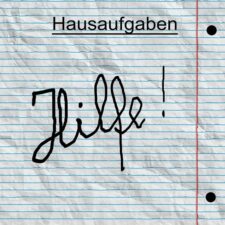Die zweite Entscheidung zum Komplex „Absprache/Verständigung“ kommt dann vom BGH. Das zugrunde liegende Verfahren ist/war nicht ganz so „schlimm“ wie das Verfahren, das zum BVerfG, Beschl. v. 20.12.2023 – 2 Bvr 2103/20 – geführt hat (dazu Absprache I: Die Amtsaufklärungspflicht gilt immer, oder: „Nachhilfe“ für AG Halle und OLG Naumburg). aber „unschön“ ist es auch, und zwar:
Das LG Stuttgart hatte den Angeklagten mit Urteil vom 20.08.2020 wegen Steuerhinterziehung in sieben Fällen, Fälschung technischer Aufzeichnungen in sechs Fällen und der Vorbereitung von Datenveränderungen in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt und gegen ihn eine Einziehungsentscheidung getroffen. Der BGH hatte mit Beschluss vom 02.06.2021 (1 StR 44/21) das Urteil wegen der Verletzung der Mitteilungspflicht (§ 243 Abs. 4 Satz 2 StPO) aufgehoben.
Im zweiten „Rechtsgang“ hat das LG den Angeklagten nunmehr wegen Fälschung technischer Aufzeichnungen in sechs Fällen und der Vorbereitung von Datenveränderungen in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt, deren Vollstreckung es zur Bewährung ausgesetzt hat und von der ein Monat wegen rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung als vollstreckt gilt. Ferner hat es die Einziehung des Wertes von Taterträgen und von Gegenständen angeordnet.
Dieser Versuch ist erneut gescheitert. Denn die hiergegen vom Angeklagten u.a. mit der Beanstandung der Verletzung formellen geführte Revision hatte erneut mit einer Verfahrensrüge Erfolg, weil das LG nach Auffassung des BGH nun im Rahmen der Verfahrensverständigung § 257c Abs. 1 Satz 2 StPO verletzt hat.
Denn: Nach dem Vorschlag der (Wirtschafts)Strafkammer sollte der Angeklagte neben einem abzugebenden Geständnis zusätzlich als weitere Voraussetzung einer Verfahrensverständigung auch „keine Beweisanträge bzw. sonstige Anträge“ stellen. Im Gegenzug sicherte die Kammer zu, eine Gesamtfreiheitsstrafe zwischen einem Jahr zwei Monaten und einem Jahr fünf Monaten zu verhängen, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird.
Dazu der BGH im BGH, Beschl. v. 10.01.2024 – 1 StR 413/23:
„Mit diesem Vorschlag, den der Angeklagte und die Verfahrensbeteiligten zugestimmt haben, hat das Landgericht die Zusage eines bestimmten Strafrahmens unsachgemäß mit einem vom Angeklagten erwarteten Prozessverhalten geknüpft. Der Generalbundesanwalt hat hierzu ausgeführt:
„Den umfassenden Verzicht auf Prozessanträge gegen die Zusicherung eines Strafrahmens hat der Gesetzgeber als zu weitgehend erachtet (BT-Drucks. 16/12310, S. 13). Allenfalls einzelne Anträge können zum Gegenstand der Verständigung gemacht werden (vgl. § 257c Abs. 2 Satz 1 Variante 3 StPO). Anderenfalls wäre die Verletzung der Aufklärungspflicht zu besorgen, die der Verständigung entzogen ist (§ 257c Abs. 1 Satz 2, § 244 Abs. 2 StPO). Eine solch weitgehende Unterwerfung ist mit der Subjektstellung des Angeklagten unvereinbar, die auch bei Urteilsabsprachen zu wahren ist (Senat, Beschluss vom 21. September 2022 – 1 StR 479/21 -, NStZ 2023, 56; vgl. hierzu auch BGH, Beschluss vom 3. März 2005 – GSSt 1/04 – BGHSt 50, 40, 48; BGH, Beschluss vom 18. Mai 2006 – 4 StR 153/06 -, NStZ 2006, 586).“
Dem tritt der Senat bei. Der Rechtsfehler nötigt zur Aufhebung des Urteils, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Urteil auf diesem beruht.“
Auch hier: Nachhilfe, und die Empfehlung, dann vielleicht doch mal in einem Kommentar usw. – ich weiß, ich weiß, ich weiß 🙂 – nachzulesen. Dann klappt es vielleicht im 3. Anlauf.