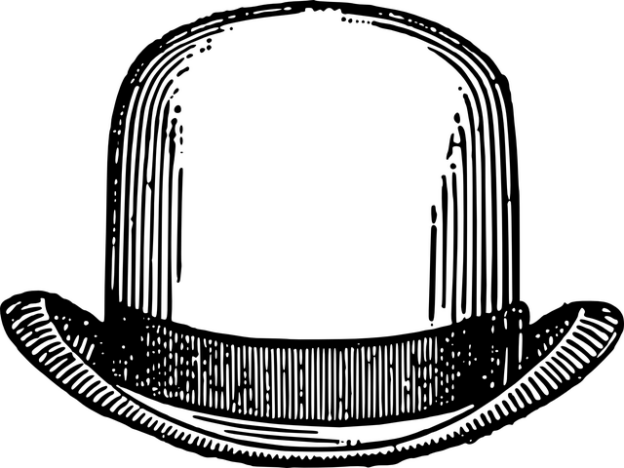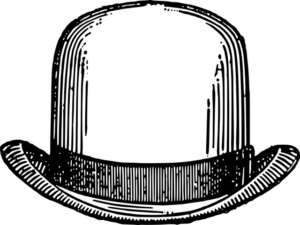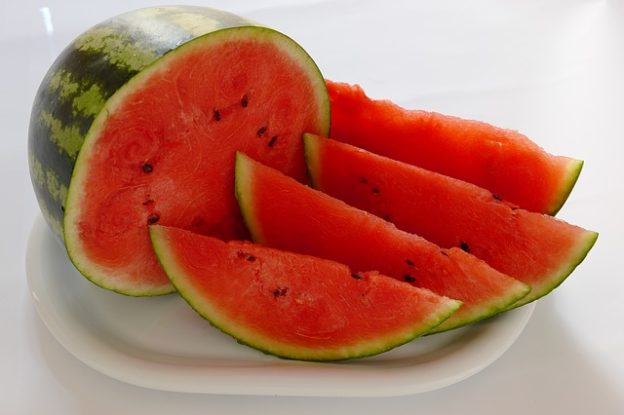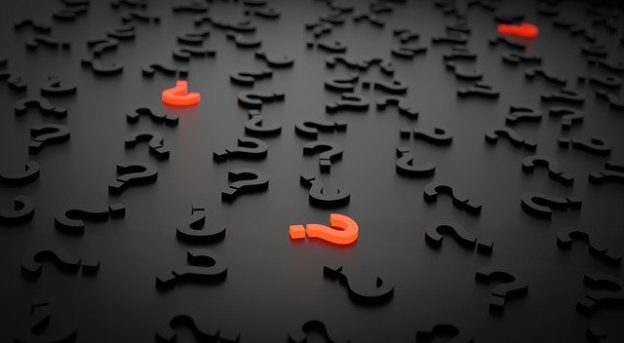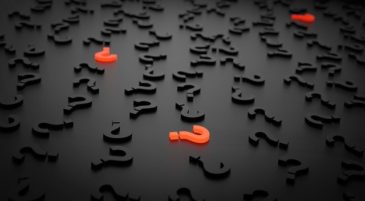Ich mache heute einen StGB-Tag.
Den Opener macht ein Klassiker. Der BGH, Beschl. v. 29.11.2023 – 6 StR 191/23 – nimmt nämlich noch einmal zur Zueignung und der Manifestation des Zueignungswillens bei § 246 StGB Stellung.
Das LG hatte den Angeklagten u.a. wegen Unterschlagung eines sicherungsübereigneten Tiefladers verurteilt. Dagegen die Revision des Angeklagten, die erfolgreich war.
„3. Während die Verurteilungen wegen veruntreuender Unterschlagung in den weiteren Fällen II.2 der Urteilsgründe keinen Bedenken begegnen, hat diejenige im Fall II.2.b der Urteilsgründe keinen Bestand, weil sich der Angeklagte den im Eigentum der T. AG stehenden Tieflader nicht zugeeignet hat.
a) Eine Zueignung im Sinne des § 246 Abs. 1 StGB setzt nach der von der bisherigen Rechtsprechung abweichenden Auffassung des Senats voraus, dass der Täter sich die Sache oder den in ihr verkörperten wirtschaftlichen Wert wenigstens vorübergehend in sein Vermögen einverleibt und den Eigentümer auf Dauer von der Nutzung ausschließt (vgl. MüKo-StGB/Hohmann, 4. Aufl., § 246 Rn. 36; SK-StGB/Hoyer, 9. Aufl., § 246 Rn. 29; Hohmann/Sander, Strafrecht BT, 4. Aufl., § 37 Rn. 9 ff.; Kudlich/Koch, JA 2017, 184, 185; im Ausgangspunkt ebenso BGH, Beschluss vom 5. März 1971 – 3 StR 231/69, BGHSt 24, 115, 119; unter Betonung der Ent- bzw. Aneignungskomponente Maiwald, Der Zueignungsbegriff im System der Eigentumsdelikte, 1970, S. 191, 196; Samson, JA 1990, 5, 9). Eine bloße Manifestation des Zueignungswillens genügt nicht, kann aber ein gewichtiges Beweisanzeichen für den subjektiven Tatbestand sein.
aa) Gestützt wird dieses Verständnis durch den Wortlaut des § 246 StGB, wonach derjenige eine Unterschlagung begeht, der sich oder einem Dritten eine Sache rechtswidrig zueignet. Mit dieser Formulierung schreibt der Gesetzgeber fest, dass eine Zueignung tatsächlich eingetreten sein muss; die Vorschrift ist als Erfolgsdelikt ausgestaltet (vgl. Hohmann/Sander, aaO, Rn. 13).
bb) Auch die Gesetzgebungsgeschichte spricht für eine rechtsgutbezogene Auslegung des Begriffs der Zueignung. So wurde der Anwendungsbereich des § 246 StGB mit dem Sechsten Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 26. Januar 1998 (BGBl. 1998 I 164), das – neben der Einbeziehung sogenannter Drittzueignungen – den Wegfall des Gewahrsamserfordernisses vorsah (vgl. dazu auch BT-Drucks. 13/8587, 43 f.), erheblich ausgeweitet (vgl. auch MüKo-StGB/Hohmann, aaO, Rn. 30). Um nach der Gesetzesänderung die Tathandlung und den Vollendungszeitpunkt unter Wahrung des Bestimmtheitsgebots (Art. 103 Abs. 2 GG) zu konkretisieren und die Grenze zur Versuchsstrafbarkeit (§ 246 Abs. 3 StGB) konturieren zu können (vgl. dazu SSW-StGB/Kudlich, 5. Aufl., § 246 Rn. 17), ist der Unterschlagungstatbestand – und damit notwendigerweise das Tatbestandsmerkmal „zueignet“ – auf tatsächliche Eigentumsbeeinträchtigungen zu beschränken.
cc) Für dieses Ergebnis streiten zudem gesetzessystematische Erwägungen. So setzt die Zueignungsabsicht beim Diebstahl voraus, dass sich der Täter unter dauerhaftem Ausschluss der Nutzungsmöglichkeit des Berechtigten die Sache oder den in ihr verkörperten Wert seinem Vermögen zumindest vorübergehend einverleiben will (st. Rspr., vgl. für viele BGH, Urteil vom 26. September 1984 – 3 StR 367/84, NJW 1985, 812; Beschluss vom 10. Oktober 2018 – 4 StR 591/17, BGHSt 63, 215, 219 mwN). Der in § 242 Abs. 1 StGB verwendete Begriff der Zueignung entspricht demjenigen des § 246 Abs. 1 StGB (vgl. BGH, Beschluss vom 5. März 1971 – 3 StR 231/69, BGHSt 24, 115, 119); der Unterschied besteht (lediglich) darin, dass diese bei der Unterschlagung in die Tat umgesetzt sein muss, während beim Diebstahl die Absicht hierzu genügt (vgl. SK-StGB/Hoyer, aaO, Rn. 9; SSW-StGB/Kudlich, aaO, Rn. 11; Hohmann/Sander, aaO, Rn. 7). Der Umstand, dass sich der Täter zivilrechtlich eine fremde Sache nicht erfolgreich „zueignen“, sondern an ihr allenfalls im Wege der §§ 946 ff. BGB Eigentum erwerben kann (vgl. auch SSW-StGB/Kudlich, aaO, Rn. 11: „scheinbare Eigentümerstellung“), steht einem – strafrechtsautonom zu beurteilenden – Zueignungserfolg nicht entgegen.
dd) Schließlich ist dieses Begriffsverständnis auch aus teleologischer Sicht geboten. So ist bei der Auslegung des Tatbestandsmerkmals „zueignet“ die Begrenzung des Strafrechts als „ultima ratio“ zu beachten (vgl. Hohmann/Sander, aaO, Rn. 9). Eine Strafbarkeit wegen Unterschlagung muss somit in jedem Fall zum Schutz des Eigentums erforderlich sein; dieser Vorgabe ist durch eine präzise Beschreibung des Unrechts des § 246 StGB – die nach dem 6. StrRG nur durch das (einzige) Tatbestandsmerkmal „zueignet“ erfolgen kann – Rechnung zu tragen (MüKo-StGB/Hohmann, aaO, Rn. 30; Hohmann/Sander, aaO). Eine Zueignung setzt demnach mindestens voraus, dass die Befugnisse des jeweiligen Eigentümers – also sein Nutzungs- oder sein Ausschlussrecht aus § 903 BGB – beeinträchtigt werden. Hingegen würde eine vom Rechtsgut des § 246 StGB losgelöste Interpretation den zulässigen Anwendungsbereich des Strafrechts überdehnen, denn der Unterschlagungstatbestand könnte in Folge des Wegfalls des Gewahrsamserfordernisses Konstellationen erfassen, in denen Eigentümerinteressen nicht einmal abstrakt gefährdet würden (vgl. Hohmann/Sander, aaO, Rn. 11 mwN).
b) Soweit es hingegen die Rechtsprechung (vgl. RG, Urteil vom 10. Juli 1939 – 3 D 513/39, RGSt 73, 253, 254; BGH, Urteile vom 19. Juni 1951 – 1 StR 42/51, BGHSt 1, 262, 264; vom 17. März 1987 – 1 StR 693/86, BGHSt 34, 309, 311 f.; vom 6. September 2006 – 5 StR 156/06, NStZ-RR 2006, 377; Beschluss vom 5. März 1971 – 3 StR 231/69, BGHSt 24, 115, 119) bisher für eine Zueignung im Sinne des § 246 Abs. 1 StGB ausreichen lässt, dass sich der Zueignungswille des Täters in einer nach außen erkennbaren Handlung manifestiert („weite Manifestationstheorie“, für eine Beschränkung auf „eindeutige“ Handlungen vgl. etwa Lackner/Kühl/Heger, 30. Aufl., § 246 Rn. 4; ähnlich Schönke/Schröder/Eser/Bosch, StGB, 30. Aufl., § 246 Rn. 10; vgl. ferner jeweils mit einem Überblick über den Meinungsstand nach dem 6. StrRG SK-StGB/Hoyer, aaO, Rn. 9 ff.; NK-StGB/Kindhäuser/Hoven, 6. Aufl., § 246 Rn. 11 ff.; Kudlich, JuS 2001, 767), überzeugt dies aus den zuvor ausgeführten Gründen nicht. Auch wenn ein solcher Manifestationsakt häufig mit einer Eigentumsbeeinträchtigung einhergehen dürfte und als Beweisanzeichen für den subjektiven Tatbestand gewertet werden kann (vgl. MüKo-StGB/Hohmann, aaO, Rn. 31), so sind doch Fälle denkbar, in denen der jeweilige Täter sich als Eigentümer „geriert“, gleichwohl aber keinerlei Verkürzung der Positionen des Berechtigten droht (vgl. Sander/Hohmann, NStZ 1998, 273, 276). Eine Bestrafung wegen vollendeter Unterschlagung würde zu einem Wertungswiderspruch zu den allgemeinen Grundsätzen der – nach § 246 Abs. 3, §§ 22, 23 Abs. 1 StGB möglichen – Versuchsstrafbarkeit führen, die regelmäßig voraussetzt, dass das geschützte Rechtsgut (bereits) durch den Tatplan unmittelbar gefährdet wird (vgl. etwa BGH, Urteil vom 12. August 1997 – 1 StR 234/97, BGHSt 43, 177, 180).
c) Trotz der Divergenz war ein Anfrageverfahren gemäß § 132 Abs. 3 Satz 1 GVG nicht veranlasst. Denn nach beiden Auffassungen hat der Angeklagte in den Fällen II.2.c, f und g den Tatbestand des § 246 Abs. 1 StGB erfüllt, während im Fall II.2.b der Urteilsgründe in Bezug auf den Tieflader weder ein Zueignungserfolg noch ein Manifestationsakt festgestellt ist.
aa) So liegt in dem bloßen Unterlassen der geschuldeten Rückgabe sicherungsübereigneter Gegenstände keine vollendete Zueignung, denn ein solches beeinträchtigt die Eigentümerbefugnisse nicht weitergehend, als bereits durch die im Rahmen des Miet- oder Leasingvertrags erfolgte Gebrauchsüberlassung geschehen. Verbirgt oder verkauft der Täter allerdings Gegenstände, die sich in seinem Besitz befinden oder gebraucht er sie in einer Weise, mit der ein erheblicher Wertverlust einhergeht – wie in den Fällen II.2.c, f und g -, liegt ein nach der Ansicht des Senats notwendiger Zueignungserfolg vor, denn der Täter verleibt sich hierdurch die jeweiligen Sachen bzw. deren Sachwert wenigstens vorübergehend in sein Vermögen ein und schließt den Berechtigten – hier der jeweilige Sicherungsnehmer – insoweit von seinen Nutzungsmöglichkeiten aus. Hingegen ist im Fall II.2.b in Bezug auf den Tieflader lediglich festgestellt, dass der Angeklagte nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens „weder den Insolvenzverwalter über die Existenz und den Standort (…) in Kenntnis setzte, (…) noch gegenüber der T. vorbehaltlos die Herausgabe (…) anbot, sondern diese(n) weiterhin in Besitz behielt“ und dessen Sicherstellung erst „ein knappes Jahr später (…) durch einen für die T. tätigen Sichersteller“ gelang. Eine Beeinträchtigung der Eigentümerbefugnisse der T. AG, die einen Zueignungserfolg im Sinne des § 246 Abs. 1 StGB begründen könnte, ergibt sich aus diesem „bloßen“ Unterlassen der Herausgabe nicht.
bb) Auch nach Ansicht der bisherigen Rechtsprechung ist für eine Unterschlagung sicherungsübereigneter Gegenstände erforderlich, dass der Täter – über ihr „Behalten“ hinaus – ein Verhalten an den Tag legt, aus dem geschlossen werden kann, dass er sich als Eigentümer „geriert“, wobei ein Verbergen (vgl. RG, Urteil vom 7. November 1938 – 3 D 769/38), ein Verkauf (vgl. BGH, Urteil vom 17. Oktober 1961 – 1 StR 382/61, NJW 1962, 116, 117), aber auch ein Gebrauch der Gerätschaften ausreichen kann, wenn mit ihm ein erheblicher Wertverlust einhergeht (vgl. BGH, Urteil vom 17. März 1987 – 1 StR 693/86, BGHSt 34, 309, 311 f. mwN). Während das Landgericht ein solches Vorgehen in den weiteren Fällen II.2 jeweils festgestellt hat, lässt sich dies Fall II.2.b der Urteilsgründe nicht entnehmen. Insbesondere ergibt sich ein solches nicht aus der E-Mail des Angeklagten vom 23. Mai 2019, in der er mit der T. AG über die Herausgabe des Tiefladers „verhandelte“, weil er zu diesem Zeitpunkt – das Insolvenzverfahren wurde am 27. Mai 2019 eröffnet – seine Verfügungsbefugnis noch nicht verloren hatte (§ 80 Abs. 1 InsO). Auf das ihm am 28. Mai 2019 unterbreitete Angebot einer Ablösesumme hat der Angeklagte indes nicht mehr reagiert.“
Wie gesagt ein Klassiker. Ich habe zu der Problematik vor „unvordenklicher Zeit“ im Studium mal eine Hausarbeit schreiben müssen. Kleiner oder großer StGB-Schein, ich weiß es nicht mehr :-). Lang, lang ist es her.