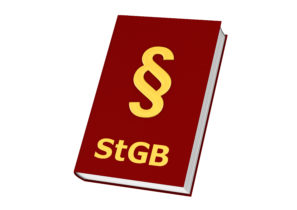Als zweite Entscheidung dann etwas zum Widerruf der Bewährung, aber: Absehen vom Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung, und zwar Absehen vom Widerruf nach nachträglicher Auflagenerfüllung.
Der Sachverhalt ergibt sich aus dem OLG Braunschweig, Beschl. v. 20.09.2023 – 1 Ws 166/23 :
„…..Darüber hinaus ist sie teilweise begründet.
a) Die Voraussetzungen für einen Widerruf der mit Urteil des Landgerichts Braunschweig vom 20. September 2021 gewährten Strafaussetzung zur Bewährung liegen nach § 56f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StGB vor. Danach widerruft ein Gericht die Strafaussetzung, wenn die verurteilte Person wie hier gröblich oder beharrlich gegen eine Auflage verstößt.
Der Verurteilte hat in der Zeit nach dem 21. August 2022 bis Ende Juli 2023 keine Zahlungen auf die ihm mit Beschluss vom 20. September 2023 erteilte zulässige Zahlungsauflage geleistet, obwohl er seitens des Landgerichts auf diese Auflage sowie ausgebliebene Zahlungen, insbesondere auch nach der Zahlung vom 21. August 2022, hingewiesen worden ist. Dadurch hat er gröblich und beharrlich gegen die erteilte Zahlungsauflage verstoßen.
Dieser Verstoß war auch schuldhaft, insbesondere war der Verurteilte zahlungsfähig. Er konnte bis August 2021 die Zahlungen leisten und sich Ende des Jahres 2022 eine mehrmonatige Reise in die Türkei leisten, ohne seine Wohnung in Deutschland aufgeben zu müssen. Einer Leistung der Zahlungen stand auch nicht der Aufenthalt des Verurteilten in der Türkei entgegen, zumal der Verurteilte bereits vorher mehrere Monate gegen die Auflage gröblich und beharrlich verstoßen hatte. Denn er hätte die Zahlungen auch von der Türkei aus ausführen können oder für deren Ausführung von dort durch Dritte sorgen müssen. Für seine Zahlungsfähigkeit spricht auch, dass es dem Verurteilten nach seiner Rückkehr aus der Türkei möglich war, die Auflage durch Zahlung von zwei nicht unerheblichen Beträgen in Höhe von 350,- und 1.000,¬€ vollständig zu begleichen.
Die gewährte Strafaussetzung zur Bewährung wäre deshalb grundsätzlich wie zunächst zutreffend vom Landgericht Braunschweig beschlossen zu widerrufen gewesen. Allein die nachträgliche und vollständige Erfüllung der Zahlungsauflage steht einem Widerruf aufgrund des bereits eingetretenen Verstoßes gegen die Auflage nicht entgegen (Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom 30. August 2004 2 Ws 190/04 , Rn. 17, juris; OLG Koblenz, Beschluss vom 24. Oktober 1980 1 Ws 600/80 , juris).
b) Vorliegend genügt es aber, die Bewährungszeit als mildere Maßnahme um ein Jahr zu verlängern.
Nach § 56f Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 StGB sieht ein Gericht von einem Widerruf ab, wenn es ausreicht, die Bewährungszeit zu verlängern.
Die Generalstaatsanwaltschaft hat hierzu ausgeführt:
„Letztlich reicht jedoch die als gegenüber dem Widerruf mildere Maßnahme der Verlängerung der Bewährungszeit um ein Jahr vorliegend aus (§ 56 f Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 StGB), ein Widerruf der Strafaussetzung dürfte sich demgegenüber nunmehr als unverhältnismäßig darstellen.
Eine Verlängerung der Bewährungszeit ist bei der vorliegenden Widerrufskonstellation auch dann zulässig, wenn sie weder zu spezialpräventiven Zwecken noch zu dem Zweck, die Ratenzahlung auf eine noch unerfüllte Auflage innerhalb der Bewährungszeit zu ermöglichen, erfolgt (vgl. Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom 30. August 2004 – 2 Ws 190/04 -, juris, Rn. 21f.). Die Bewährungszeit kann trotz der unterschiedlichen Zwecke von Auflagenerteilung und Bemessung der Bewährungszeit auch dann gemäß § 56 f Abs. 2 StGB verlängert werden, wenn Grund für den Widerruf der Strafaussetzung nach § 56 f Abs. 1 StGB der Verstoß gegen eine Auflage ist, die der Verurteilte nachträglich vollständig erfüllt hat (Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, a.a.O., – Leitsatz ). Trotz des funktionalen Unterschiedes kann auf den Verstoß gegen eine inzwischen erledigte Auflage mit einer Verlängerung der Bewährungszeit reagiert werden (Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, a.a.O.; im Erg. ebenso OLG Koblenz in NStZ 1981, 101 – Leitsatz ).
Eine spürbare Verlängerung der Bewährungszeit um ein Jahr reicht hier aus, erscheint aber angesichts der erheblichen Verzögerungen in der Auflagenerfüllung und dem Gewicht des entsprechenden Schuldvorwurfs auch geboten und deshalb im beantragten Umfang verhältnismäßig.“
Dem schließt sich der Senat an. Der Verurteilte hat nach Einreichung seines Antrages auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und Einlegung der sofortigen Beschwerde die Zahlungsauflage noch innerhalb der mit Beschluss vom 20. September 2021 festgesetzten Bewährungszeit vollständig erfüllt und damit nachträglich die Genugtuung für das begangene Unrecht in dem vollen vom erkennenden Landgericht für erforderlich erachteten Umfang geleistet. Weitere Gesichtspunkte die für einen Widerruf der Strafaussetzung sprechen könnten sind nicht ersichtlich. Daher genügt es, die Bewährungszeit um ein Jahr zu verlängern.“