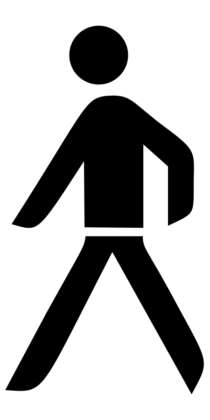Im „Kessel Buntes“ stelle ich heute zwei zivilrechtliche Entscheidungen vor. Beide haben mit „Fahrradunfällen“ zu tun.
„Bei der gebotenen Abwägung im Rahmen des § 254 Abs. 1 BGB ist in erster Linie das Maß der Verursachung maßgeblich, in dem die Beteiligten zur Schadensentstehung beigetragen haben; das beiderseitige Verschulden ist nur ein Faktor der Abwägung (vgl. etwa BGH, Urteil vom 9. Juli 1968 – VI ZR 171/67 – VersR 1968, 1093, 1094 m.w.N.; vom 20. Januar 1998 – VI ZR 59/97 – VersR 1998, 474, 475). Es kommt danach für die Haftungsverteilung entscheidend darauf an, ob das Verhalten des Schädigers oder das des Geschädigten den Eintritt des Schadens in wesentlich höherem Maße wahrscheinlich gemacht hat (vgl. BGH, Urteile vom 20. Januar 1998 – VI ZR 59/97 – aaO; vom 12. Juli 1988 – VI ZR 283/87 – VersR 1988, 1238, 1239 m.w.N.).
Vorliegend ist dem Kläger ein Verstoß gegen § 5 Abs. 4 S. 2 StVO anzulasten. Auch auf Radwegen sind die Vorschriften der StVO zu beachten. Aus dem Umstand, dass der Reiter den Radweg nicht benutzen darf, folgt nicht, dass hierdurch die Verkehrsregeln diesem gegenüber außer Kraft treten. Gemäß § 5 Abs. 4 S. 2 StVO muss beim Überholen ein ausreichender Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern eingehalten werden. Auch Radfahrer haben den nach § 5 Abs. 4 Satz 2 StVO erforderlichen Seitenabstand einzuhalten. Welcher Abstand geboten ist, hängt von den konkreten Bedingungen des Einzelfalls ab. Der Abstand muss so groß sein, dass Schreckreaktionen der überholten Verkehrsteilnehmer nicht zu erwarten sind. Beim Überholen von Pferden und Zugtieren ist gehörig Abstand zu halten (Helle in: Freymann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 1. Aufl., § 5 StVO (Stand: 22.07.2019) Rn. 68 ff.). Dabei ist zwar grundsätzlich ein Seitenabstand beim Passieren eines anderen Verkehrsteilnehmers von einem Meter ausreichend. Dies gilt aber nicht, wenn zum Beispiel ein Radfahrer oder ein Reiter passiert werden muss, weil im ersteren Fall mit Schlenkern und beim Reiter oder auch anderen Tieren mit einer plötzlichen Reaktion des Tiers gerechnet werden muss (OLG Celle NJW-RR 2018, 728; OLG Celle, Urt. v. 19.12.2002 – 14 U 94/02, BeckRS 2002, 30299252), sodass ein Seitenabstand von wenigstens 1,5 bis etwa 2 m einzuhalten ist (OLG Celle NJW-RR 2018, 728; OLG Brandenburg, NJW-RR 2011, Seite 1400; Hentschel/König/Dauer, StraßenverkehrsR, 44. Aufl. 2017, § 5 StVO Rn. 54, 55). Diesen auch hier erforderlichen Seitenabstand hat der Kläger nach eigenem Vortrag nicht eingehalten. Er hat im Rahmen seiner informatorischen Anhörung selbst angegeben, dass er in einem Abstand von einem „guten Meter“ an dem Pferd vorbeigefahren ist. Als das Pferd dann ausgetreten habe, sei er seitlich neben dem Pferd, mit dem Oberkörper vielleicht noch 30-40 cm seitlich hinter den Hinterbeinen gewesen (Seite 3 des Sitzungsprotokolls, Bl. 126 d.A.). Dass ein größerer Abstand aufgrund der geringen Breite des Radweges nicht eingehalten werden konnte, kann den Kläger nicht entlasten. Es war ihm unbenommen, sich mit den Reitern über die Möglichkeit eines Passierens oder eines Ausweichortes zu verständigen. Unabhängig davon, ob durch die Reiter der Versuch einer Verständigung unternommen wurde, hätte ein solcher auch von dem Kläger ausgehen können. Es ist auch nicht deshalb ein geringerer Seitenabstand zu fordern, weil es sich nicht um ein Kraftfahrzeug, sondern um ein Liegefahrrad handelt. Der Seitenabstand dient der Vermeidung von Schreckreaktionen. Diese können ebenso durch ein Liegefahrrad, das hier noch mit einer Fahne ausgestattet war, ausgelöst werden.
Unabhängig von diesem Verstoß gegen § 5 Abs. 4 S. 2 StVO ist im Rahmen des Mitverschuldens der Verletzungsbeitrag zu berücksichtigen, den der Kläger durch das Sich-Nähern an ein Pferd von hinten mit einem zu geringen Abstand gesetzt hat. Dieser ist dann von Bedeutung, wenn der Verletzte „ohne Not an einem fremden Pferd so nahe vorbeigeht, dass er den Angriffs- oder Verteidigungsbewegungen des Pferdes … ausgesetzt ist“ (RG JW 1906, 739; s. auch BGH JZ 1955, 87). Bei einer Entfernung von unter 150 cm besteht die Gefahr, beim Auskeilen von einem Huf getroffen zu werden. Dies ist auch nicht lediglich einem erfahrenen Reiter bekannt. Es ist allgemein bekannt, dass sich hinter einem Pferd ein spezifischer („Austreten“) Gefahrenbereich befindet (vgl. OLG Koblenz, Urteil vom 31. Januar 2002 – 5 U 465/01 –, juris, VersR 2003, 1317; OLG Stuttgart, Urteil vom 24. Januar 2011 – 5 U 114/10 –, juris Rn 23). Allein daraus, dass in den Entscheidungen, die sich auf einen Reiter beziehen, ausgeführt wird, dass dies jedem Reiter bekannt sei (OLG Hamm, Urteil vom 16. November 2018 – 9 U 77/17 –, juris), kann nicht der Umkehrschluss gezogen werden, dass es anderen Personen (Nicht-Reitern) nicht bekannt sei. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Absicht der Reiter, die Konfrontation der Pferde mit dem Liegefahrrad zu vermeiden, für den Kläger erkennbar gewesen wäre. Denn die Reiter sind diesem zunächst entgegen geritten und haben dann, nachdem sie in Sichtweite waren, gewendet. Zwar ist nicht erwiesen, dass die Zeugen dem Kläger akustisch verständlich ihr Vorhaben erklärt haben. Die Zeugin A hat angegeben, sie hätten zwar auch was zu dem Radfahrer gesagt, aber sie vermute, dass er das nicht gehört habe (vgl. Seite 9 des Sitzungsprotokolls, Bl. 132). Allerdings ist das Gericht davon überzeugt, dass die Zeugen dem Kläger per Handzeichen mit einer Drehbewegung ihre Wendeabsicht angezeigt haben. Die Zeugin A hat angegeben, sie hätten versucht, dem Fahrradfahrer zu erklären, dass sie umdrehen, um auf die Wiese zu kommen. Sie hat angegeben, die Handzeichen habe der Zeuge B gemacht. Sie selbst könne nicht mehr sagen, wie genau er die Handzeichen gemacht habe (vgl. Seite 9 des Sitzungsprotokolls, Bl. 132). Auch der Zeuge B hat angegeben, sie hätten dem Kläger mit einem Handzeichen zu verstehen gegeben, dass sie umdrehen. Er hat auf Nachfrage eine Drehbewegung mit dem Zeigefinger in der Luft gemacht (vgl. Seite11 des Sitzungsprotokolls, Bl. 134 d.A.). Das Gericht erachtet die Zeugen als glaubwürdig und die Angaben als glaubhaft. Die jungen Zeugen ließen keinerlei Belastungseifer oder Entlastungstendenz erkennen. Vielmehr schilderten sie das Geschehen aus ihrer Erinnerung und ließen dabei auch für sie ungünstige Umstände nicht aus. So hat beispielsweise die Zeugin A selbst angegeben, dass der Kläger das, was sie sagten, vermutlich nicht hören konnte. Dass die Zeugin selbst sich an die konkrete Ausführung des Handzeichens, das sie selbst auch nicht gemacht hat, nicht erinnern konnte, ist demgegenüber nachvollziehbar und auch dies legte die Zeugin offen dar. Aufgrund des Handzeichens hätte der Kläger den nach dem Sichtkontakt erfolgten Wendevorgang der Reiter mit seiner Anwesenheit und der Enge des Radwegs in Verbindung bringen und damit die Absicht der Reiter, eine Konfrontation zu vermeiden, erkennen können.
Bei Abwägung der wie dargelegt aus § 833 BGB folgenden Haftung mit diesem aus dem unterschrittenen Sicherheitsabstand folgenden Verursachungsbeitrag erachtet die Kammer eine hälftige Haftungsverteilung für angemessen. Die Tiergefahr ist dabei bei einem Reitpferd schon im Hinblick auf die Größe, Masse und Kraft im Sinne einer „Betriebsgefahr“ hoch zu veranschlagen (vgl. OLG Koblenz, Urteil vom 31. Januar 2002 – 5 U 465/01 –, juris, VersR 2003, 1317). Zudem ist die grundsätzliche Kenntnis der Beklagten von der Nutzung des Radweges zu berücksichtigen. Allerdings ist auf der Klägerseite der Verstoß gegen § 5 Abs. 4 S. 2 StVO in die Bemessung einzustellen. Nach Auffassung der Kammer ist dieser Verursachungsbeitrag mit 50% zu gewichten. Zwar wurde in der Rechtsprechung vielfach in Fällen, in denen sich ein Reiter ohne Sicherheitsabstand hinter einem Pferd befand, ein etwas geringeres Mitverschulden von etwa 1/3 zugrunde gelegt. Der vorliegende Fall unterscheidet sich davon jedoch zum einen dadurch, dass sich der Kläger dem Pferd nicht lediglich zu Fuß, sondern mit einem ungewöhnlich und für das Pferd unbekannten Fahrzeug genähert hat, was eine Schreckreaktion gegenüber der bloßen Anwesenheit einer Person noch begünstigt. Zum anderen liegt nicht lediglich eine Verletzung der Sorgfalt vor, die zum Schutz der eigenen Person erforderlich ist, sondern zugleich ein Verstoß gegen § 5 Abs. 4 S. 2 StVO, der in den klägerseits angeführten Entscheidungen nicht zu berücksichtigen war. Im Falle eines einen Radweg benutzenden Fußgängers wurde dessen Haftungsquote bei einer Kollision mit einem Radfahrer mit lediglich 25% angenommen (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 13. Januar 2003 – I¬1 U 110/02 –, juris). Auch im Falle eines entgegen der Benutzungspflicht des Radweges auf der Fahrbahn fahrenden Radfahrers wurde dessen Haftungsquote bei einer Kollision mit einem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht wahrenden Pkw mit 25 % angenommen (OLG Hamm, Urteil vom 28. Oktober 1993 – 6 U 91/93 –, juris). Der aus einer verbotswidrigen Nutzung eines Radweges oder einer Fahrbahn folgende Verursachungsbeitrag wird demnach gegenüber einem Verstoß gegen den erforderlichen Seitenabstand, der letztlich den Eintritt des Schadens verursacht hat, als geringer angesehen. Vorliegend war diese Quote jedoch auf Beklagtenseite aufgrund der spezifischen Tiergefahr zu erhöhen. Nach Auffassung der Kammer haben vorliegend bei einer Abwägung der beiderseitigen Verursachungsbeiträge aufgrund der erörterten Umstände die spezifische Tiergefahr bei durch die Beklagte in Kauf genommener Benutzung des Radweges und der sorgfaltswidrige Überholvorgang durch den Kläger in gleicher Weise zu dem Schaden beigetragen und sind gleich zu gewichten.“