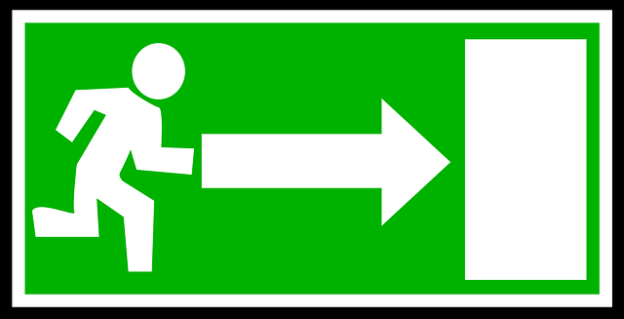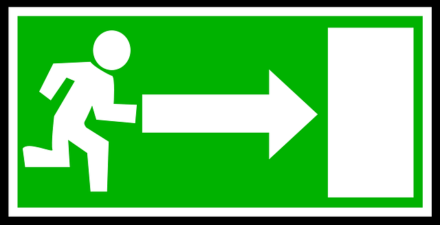Der Tag heute ist dann der Entschädigung nach dem StrEG gewidmet. Zu der Problematik haben sich in der letzten Zeit einige Entscheidungen angesammelt.
„§ 5 Abs. 2 Satz 1 StrEG enthält einen Ausnahmetatbestand. Bei der Beurteilung der Frage, ob der Beschuldigte Anlass zu der Strafverfolgungsmaßnahme gegeben hat, ist deshalb ein strenger Maßstab anzulegen (vgl. BGH StraFo 2010, 87; KG StraFo 2009, 129; KG, Beschlüsse vom 18. April 2007 – 4 Ws 47/04 – und 20. Juni 2006 – 4 Ws 41/05 –). Es reicht daher nicht aus, dass sich der Freigesprochene irgendwie verdächtig gemacht hat und die gesamte – allein oder überwiegend aufgrund anderer Beweismittel bestehende – Verdachtslage die ergriffene Strafverfolgungsmaßnahme rechtfertigt (vgl. BGH StraFo 2010, 87; Senat, Beschluss vom 11. Januar 2012 – 2 Ws 351/11 –, juris). Erforderlich ist vielmehr, dass er die Maßnahme durch die Tat selbst oder sein früheres oder nachfolgendes Verhalten ganz oder überwiegend verursacht hat (vgl. BGH bei Holtz MDR 1983, 450; KG StraFo 2009, 129; KG, Beschlüsse vom 20. Juni 2006 – 4 Ws 41/05 – und vom 9. März 1999 – 4 Ws 24/99 –, juris; Meyer-Goßner/Schmitt, StPO 63. Aufl., § 5 StrEG Rn. 7). Das Verhalten des Freigesprochenen ist nicht oder nicht mehr ursächlich, wenn die Maßnahme auch unabhängig von seinem Verhalten, welches sicher festzustellen ist (vgl. OLG Köln StraFo 2001, 146), angeordnet oder aufrechterhalten worden wäre (vgl. OLG Karlsruhe NStZ-RR 2005, 255; OLG Oldenburg StraFo 2005, 384; KG StraFo 2009, 129) oder wenn sie allein oder im Wesentlichen auf anderen Beweisen beruht (vgl. Senat aaO mwN). Im Zweifelsfall ist zu seinen Gunsten zu entscheiden (vgl. KG StraFo 2009, 129; KG, Beschlüsse vom 18. April 2007 – 4 Ws 47/04 – und 20. Juni 2006 – 4 Ws 41/05 –).
Ob eine schuldhafte Verursachung vorliegt, ist ausschließlich nach zivilrechtlichen Zurechnungsgrundsätzen (§§ 254, 276, 277, 278 BGB) zu beurteilen (vgl. BGH bei Holtz MDR 1983, 450, 451; KG StraFo 2009, 129; Senat aaO mwN). Dabei steht eine Verletzung der dem Geschädigten obliegenden Schadensminderungspflicht einer Mitverursachung gleich (vgl. KG StraFo 2009, 129). Der Freigesprochene hat die Ermittlungsmaßnahme dann zumindest grob fahrlässig verursacht, wenn er nach objektiven, abstrakten Maßstäben in ungewöhnlichem Maße die Sorgfalt außer Acht lässt, die ein verständiger Mensch in gleicher Lage aufwenden würde, um sich vor Schaden durch Strafverfolgungsmaßnahmen zu schützen (vgl. BGH StraFo 2010, 87; Meyer-Goßner/Schmitt, StPO 63. Aufl., § 5 StrEG Rn. 9), indem er schon einfachste, naheliegende Überlegungen anzustellen versäumt oder dasjenige nicht bedenkt, was im gegebenen Fall jedem einleuchten müsste, und so die Maßnahme „geradezu herausfordert“ (vgl. KG StraFo 2009, 129; Senat aaO mwN).
2. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das Landgericht der Freigesprochenen eine Entschädigung für die vorläufige Festnahme und die erlittene Untersuchungshaft zu Recht versagt. Diese hat ihre vorläufige Festnahme sowie die Anordnung und den Vollzug der Untersuchungshaft grob fahrlässig verursacht.
Die Strafkammer hat im Urteil festgestellt (UA S.17), dass die Freigesprochene, ihren – deshalb verurteilten – Begleiter und Mitangeklagten V. am Abend des 11. Juli 2020, in der Nähe des U-Bahnhofs Gleisdreieck in Berlin aus geringer Entfernung dabei beobachtete, wie dieser dem Zeugen M. eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole an den Kopf hielt, um ihm zur Duldung der Wegnahme eines 50-Euro-Scheines zu veranlassen, den er ihm zugleich aus der Hosentasche zog. Danach sah sie zu, wie der Mitangeklagte diesen Geldschein an eine unbekannt gebliebene männliche Person weitergab. Kurze Zeit später war sie dabei, als der Mitangeklagte einen weiteren Mann kurz vor dem U-Bahnhof schlug und ihm einen unbekannt gebliebenen Gegenstand entwendete. Als eine Gruppe von Passanten darauf aufmerksam wurde und einzelne aus der Gruppe versuchten, den Mitangeklagten V. festzuhalten, stießen und zogen die Freigesprochene sowie der weitere Mitangeklagte M. diese von dem Mitangeklagten V. fort. Die Freigesprochene schlug zudem mit ihrer Tasche nach ihnen und schrie sie an.
Im Zuge der anschließenden vorläufigen Festnahme der Mitangeklagten auf dem U-Bahnhof versuchte die Beschwerdeführerin, gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten den Tatverdacht gegen diese zu entkräften, indem sie wider besseres Wissen behauptete, insbesondere der Angeklagte V. hätte keine strafbaren Handlungen begangen. Zudem versuchte sie, – bevor ihre Personalien aufgenommen werden konnten – den Bahnhof zu verlassen, und konnte nur durch das Eingreifen eines Polizeibeamten im letzten Moment daran gehindert werden, mit einer gerade eingefahrenen U-Bahn zu entkommen. Erst daraufhin wurde auch sie vorläufig festgenommen.
a) Das Verhalten der Freigesprochenen war kausal für die Strafverfolgungsmaßnahmen. Die Beschwerdeführerin hat die freiheitsentziehenden Maßnahmen dadurch verursacht, dass sie durch ihr den Mitangeklagten V. abschirmendes Verhalten nicht nur den dringenden Verdacht einer Beteiligung an dessen Taten erzeugt, sondern durch ihren Fluchtversuch auch den Haftgrund der Fluchtgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO) geschaffen hat.
b) Ein Beschuldigter kann die Anordnung von Untersuchungshaft nicht nur dadurch verursachen, dass er durch sein Verhalten maßgeblich zur Entstehung des dringenden Tatverdachts beiträgt, sondern auch dadurch, dass er in zurechenbarer Weise (vgl. KG, StraFo 2009, 129) einen wesentlichen Ursachenbeitrag zur Begründung eines Haftgrundes – auch eines weiteren Haftgrundes (vgl. OLG Frankfurt am Main NStZ-RR 1998, 341; KG Rpfleger 1999, 350; Senat, Beschluss vom 11. Januar 2012 – 2 Ws 351/11 –, juris) – leistet (vgl. OLG Karlsruhe NStZ-RR 2005, 255, 256; OLG Brandenburg, Beschluss vom 5. Dezember 2007 – 1 Ws 273/07 – juris; Senat aaO mwN; Meyer-Goßner/Schmitt, StPO 63. Aufl., § 5 StrEG Rn. 11).
c) Die Annahme von Fluchtgefahr war aufgrund der Gesamtumstände zum Zeitpunkt der vorläufigen Festnahme und des Haftbefehlserlasses naheliegend. Die Beschwerdeführerin wurde letztlich nur freigesprochen, weil die Strafkammer im Ergebnis der mehrtätigen Beweisaufnahme zu ihren Gunsten davon ausgehen musste, dass ihre den Haupttäter unterstützenden und abschirmenden Handlungen spontan und erst nach Beendigung der Haupttat sowie der bereits anderweitig erfolgten Beutesicherung einsetzten. Der aus der Straferwartung resultierende hohe Grad der Fluchtgefahr gebot auch den Vollzug der Untersuchungshaft.
d) Das für die freiheitsentziehenden Strafverfolgungsmaßnahmen ursächliche Verhalten der Beschwerdeführerin ist nach den eingangs dargelegten Maßstäben auch zweifellos als grob fahrlässig zu werten.“