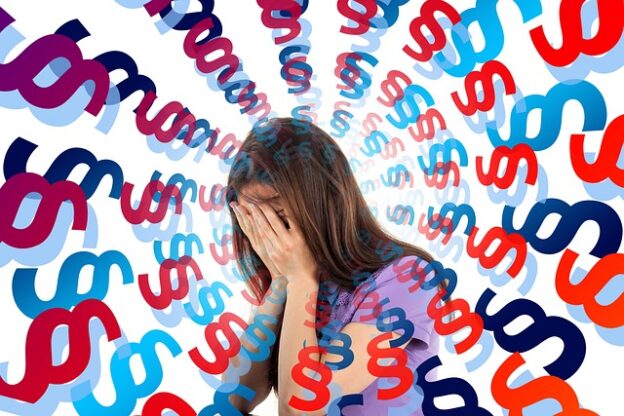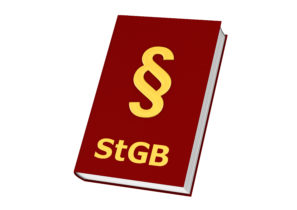Während das OLG hinsichtlich der materiellen Frage und auch hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Durchsuchung nichts zu „meckern“ hatte, hat ihm die Strafzumessung des LG nicht gefallen. Insoweit hatte die Revision daher Erfolg:
3. Der Strafausspruch hingegen hält rechtlicher Überprüfung nicht stand, so dass die Sachrüge insoweit Erfolg hat.
Die Zumessungserwägungen des Tatgerichts enthalten eine Reihe von Lücken, Widersprüchen und Ungenauigkeiten. Jedenfalls in der Gesamtschau kann der Senat deshalb nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausschließen, dass das Tatgericht entscheidende Gesichtspunkte übersehen oder falsch gewertet hat, unter deren zutreffender Berücksichtigung es zu einer milderen Strafe gelangt wäre. Im Einzelnen:
Der Auffassung der Strafkammer,
„zugunsten des Angeklagten sprach nicht mehr das erstinstanzliche Geständnis, denn im Rahmen der Berufungsverhandlung hatte er zunächst keine Angaben zur Sache gemacht, sondern vielmehr die objektiven Umstände erst im Rahmen des letzten Wortes beiläufig erklärt, wobei nicht klar war, ob er dies bewusst tat…“
vermag der Senat nicht zu folgen. Die Begründung steht im Widerspruch zur Beweiswürdigung in den Urteilsgründen. Danach hat der Angeklagte bereits nach Vernehmung der Zeugin H. deren Angaben zum Tatgeschehen bestätigt. Unklar ist auch, warum es sich beim Einräumen der objektiven Tatumstände „erst im Rahmen des letzten Wortes“ nicht um ein Geständnis handeln soll. Soweit das Tatgericht die Frage aufwirft, ob sich um ein „bewusstes“ Geständnis gehandelt hat, erschließt sich dem Senat nicht, wie Tatumstände „unbewusst“ eingeräumt werden können oder welchen konkreten Anlass die Strafkammer zu Zweifeln an der inhaltichen Qualität des Geständnisses hatte. Da das Landgericht seine offenbar vorhandenen Bedenken auch nicht ausgeräumt hat, handelt es sich hierbei letzlich um eine Vermutung. Ebenso wie es nicht zulässig ist, lediglich vermutete Umstände strafschärfend zu bewerten, können bloße Vermutungen auch nicht das Gewicht strafmildernder Umstände einschränken (BGH, Beschluss vom 21. September 1995 – 4 StR 529/95 -, juris).
Die naheliegende Überlegung, dem Geständnis schon deshalb nur geringes strafmilderndes Gewicht beizumessen, weil die betreffenden Tatsachen bereits anderweitig bewiesen waren, hat das Landgericht hingegen nicht angestellt (vgl. ausführlich Kinzig, in: Schönke/Schröder, a. a. O., § 46, Rn. 41b, m. w. N.).
b) Die Argumentation der Strafkammer,
„zu seinen Gunsten wurde nicht gewertet, dass er seine politischen Ämter bzw. weiteren Tätigkeiten durch das Bekanntwerden des Vorwurfs nicht mehr weiter ausüben konnte, denn letztlich beruhte das auf seinem eigenen, rechtswidrigem Tun“
kann ebenfalls keinen Bestand haben. Bereits aus § 60 StGB folgt, dass wirtschaftliche, berufliche oder soziale Folgen der Tat, die den Täter selbst treffen, bei der Strafzumessung zu berücksichtigen sind, auch wenn sie den Schweregrad des § 60 StGB nicht erreichen (Fischer, Strafgesetzbuch, 69. Auflage 2022, § 46, Rn. 34d). Nach den getroffenen Feststellungen hat der Angeklagte infolge der Tat nicht nur seine politischen Ämter, sondern auch Einkünfte in Höhe von rund 40.000 € jährlich verloren.
Allerdings wird die für die erneute Entscheidung zuständige Strafkammer in den Blick zu nehmen haben, dass Nachteile, die der Täter bewusst riskiert hat oder die sich ihm aufdrägen mussten, in der Regel keine Milderung veranlassen (BGH, Urteil vom 12. Januar 2016 – 1 StR 414/15 -; Urteil vom 20. Juli 2005 – 2 StR 168/05 -; beide juris). Es spricht einiges dafür, dass ein politischer Mandatsträger, der bei Ausübung seines Mandats eine Straftat begeht, mit dem Verlust oder der Aufgabe seiner politischen Ämter rechnen muss.
c) Auch der strafschärfend von der Strafkammer berücksichtigte Gesichtspunkt,
„dass er [der Angeklagte] als gewählter Volksvertreter eine Vorbildfunktion innehatte, der er nicht gerecht geworden war“,
trägt nicht. Zwar ist denkbar, dass das Verhalten des Angeklagten Nachahmer findet, zumal in der Presse über die Tat berichtet wurde. Ungewiss ist allerdings, ob ein solcher Effekt bei „gewählten Volksvertretern“ in höherem Maße als bei anderen Straftätern auftritt, so dass generalpräventive Strafzwecke bei Straftaten von Abgeordneten eine schärfere Sanktion erfordern als bei gleichartigen Taten von Tätern, die keine Abgeordneten sind. Umgekehrt entspricht es dem Wesen einer repräsentativen Demokratie, dass Abgeordnete mit unterschiedlichsten Einstellungen und Verhaltensweisen in parlamentarische Gremien gewählt werden; auch deshalb erscheint es dem Senat widersprüchlich und bedenklich, an Straftaten „gewählter Volksvertreter“ andere rechtliche Maßstäbe anzulegen als an das Verhalten sonstiger Straftäter.
d) Schließlich gibt die Formulierung
„…zumal der Angeklagte sich mit seiner Tat ausweislich der Presseberichterstattung brüstete und von Reue auch in der Berufungshauptverhandlung kein Ansatz zu erkennen war“
Anlass zu der Befürchtung, die Strafkammer könnte die fehlende Reue strafschärfend herangezogen haben. Fehlende Unrechtseinsicht und Reue sind indes für sich allein kein Strafschärfungsgrund. Strafschärfend kann ein solches Verhalten nur gewertet werden, wenn es nach der Art der Tat und nach der Persönlichkeit des Täters auf Rechtsfeindschaft, Gefährlichkeit und die Gefahr künftiger Rechtsbrüche schließen läßt (BGH, Beschluss vom 9. Juni 1983 – 4 StR 257/83 -, juris; Fischer, a. a. O., § 46, Rn. 51). Dies erscheint nach den bislang getroffenen Feststellungen eher fernliegend, zumal der Angeklagte bislang nicht vorbestraft ist.