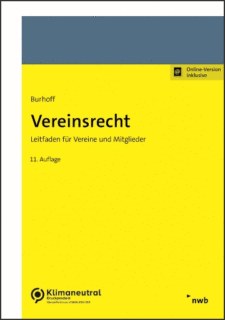Und dann haben wir noch den samstäglichen Kessel Buntes, den ich heute mit dem OLG Düsseldorf, Beschl. v. 02.10.2023 – 19 U 14/23. Das OLG nimmt in dem Beschluss im Rahmen der Entscheidung eines Antrags auf Bewilligung von PKH für das Berufungsverfahren zum Umfang der deliktischen Ansprüche nach einem Faustschlag während eines Fußballspiels und zur Höhe des Schmerzensgeldes Stellung.
Zum Sachverhalt teilt der Beschluss mit: Am 09.12.2018 spielte die Fußballmannschaft, in der der Kläger spielte, gegen die Fußballmannschaft, in der der Beklagte spielte. Während einer kurzzeitigen Unterbrechung des Spiels schlug der Beklagte dem Kläger mit der Faust ins Gesicht. Hier-durch erlitt der Kläger einen zweifachen Kieferbruch in Form einer dislozierten offenen Kieferwinkelfraktur rechts und einer Paramedianfraktur links, der am 10.12.2018 operativ behandelt wurde. Bis zum 31.12.2018 war der Kläger hierdurch arbeitsunfähig.
Das LG hat den Beklagten verurteilt, an den Kläger aus § 823 Abs. 1 BGB und § 823 Abs. 2 i.V.m. § 223 StGB ein Schmerzensgeld in Höhe von 22.000,00 EUR. Darüber hinaus stellte das LG fest, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger sämtliche materiellen und immateriellen künftigen Schäden zu ersetzen, die aus dem Schlag des Beklagten in das Gesicht des Klägers am 09.12.2018 resultieren, und es stellte fest, dass die Ansprüche des Klägers auf einer vorsätzlichen unerlaubten Handlung des Beklagten beruhen.
Der Schlag des Beklagten in das Gesicht des Klägers erfolgte zur Überzeugung des LG nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme rechtswidrig und schuldhaft. Die im Termin zur mündlichen Verhandlung vernommenen Zeugen R, H und S hätten die Behauptung des Klägers, dass der Schlag unvermittelt und ohne vorherige Provokation seinerseits erfolgte, glaubhaft bestätigt. Insbesondere habe damit nicht die vom Beklagten als Notwehrlage i.S.d. § 32 StGB verstandene, behauptete Situation vorgelegen, dass sich der Kläger bedrohlich auf den Beklagten zubewegt, hierbei seine Hand gehoben und sich der Beklagte geduckt habe, mit einem Arm abgewehrt und mit dem anderen Arm zugeschlagen habe. Diese Situation, die schon der Beklagte im Rahmen seiner Anhörung nur rudimentär und unter Aussparung wesentlicher Details habe schildern können, habe keiner der Zeugen auch nur in Ansätzen bestätigt. Darauf, ob die Parteien zu einer anderen Zeit vorher aneinandergeraten seien und der Kläger den Kapitän der Mannschaft des Beklagten mit der Schulter berührt habe, komme es nicht an. Die Vernehmung des nicht erschienenen, vom Beklagten allein für die Tatsache eines vorherigen Schubsens des Zeugen durch den Kläger benannte Zeuge pp. sei deshalb nicht mehr erforderlich gewesen. Für die rechtliche Bewertung des Angriffs des Beklagten auf den Kläger sei die vom Beklagten unter dieses Beweisangebot gestellte Behauptung unerheblich.
Hiergegen wendet sich der Beklagte in seinem Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe mit der angekündigten Berufung. Das allerdings ohne Erfolg.
Das OLG setzt sich mit den Einwänden des Beklagten gegen die Verurteilung dem Grund nach auseinander. Darauf will ich hier aber nur eine Passage zitieren, da man die Ausführungen ohne genauere Kenntnis vom angefochtenen Urteil nicht „prüfen“ kann. Das OLG führt insoweit u.a. aus:
„Denn der Beklagte trägt die Beweislast für eine behauptete Notwehrsituation gemäß § 227 BGB bzw. § 32 StGB. Eine Notwehrlage setzt einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff voraus. Ein Angriff ist gegenwärtig, wenn er unmittelbar bevorsteht oder gerade stattfindet und noch nicht beendet ist. Soweit der Beklagte den Zeugen H . für provokantes Verhalten des Klägers im vorangegangenen Spielverlauf benennt, würde ein solches Vorverhalten, selbst wenn es als wahr unterstellt würde, nicht zu einer Notwehrlage zugunsten des Beklagten führen, weil jedenfalls diese Provokationen nicht mehr gegenwärtig waren.
Entgegen der Ansicht des Beklagten im Schriftsatz vom 30.06.2023 musste das Landgericht den von der Beklagtenseite benannten Zeugen nicht anhören, weil es eben auf das vorangegangene Gesamtverhalten des Klägers im Fußballspiel insgesamt nicht ankam und auch nicht darauf, in welcher Art er gegebenenfalls gegenüber dem Beklagten vorher aggressiv, provokant oder beleidigend (Griff in den Genitalbereich) tätig geworden sei. Denn bei einer Notwehrlage, für die der Beklagte wie oben ausgeführt, beweisbelastet ist, kommt es lediglich auf die Gegenwärtigkeit eines menschlichen Angriffs an und nicht um ein Vorverhalten, das bereits abgeschlossen ist. Der Beklagte verkennt bei seiner Rechtsmeinung, dass sein Faustschlag in einer anderen Spielsituation (Unterbrechung des Spiels) zu einem anderen Zeitpunkt erfolgte.
Aber dann zum Schmerzensgeld:
„….
Aus den vom Landgericht angeführten schmerzensgeldrelevanten Aspekten hat es vertretbar ein Schmerzensgeld von 22.000 € für angemessen erachtet. Diese Einschätzung findet Anhaltspunkte in der Rechtsprechung. Die vom Kläger zitierte Entscheidung (OLG München, Urt. v. 23.01.2013, 3 U 4056/12, juris, 10.000 € zugesprochen bei beantragten 20.000 €) weist weniger festgestellte Dauerschäden der dort verletzten Person aus, als beim Kläger festgestellt wurden.
Insbesondere rechtfertigen die über die im vom Kläger zitierten Vergleichsfall hinausgehenden Dauerschäden eine signifikante Erhöhung des dort ausgeurteilten Schmerzensgeldes. Der Sachverständige stellte dauerhafte Anästhesien von zwei Nervenästen des N. mandibularis rechts im Unterkiefer fest, die zu Sabbern in der Öffentlichkeit führen können. Darüber hinaus hat der Sachverständige dauerhafte fehlerhafte Okklusionen als Dauerschaden festgestellt. Nach den Feststellungen des Sachverständigen leidet der Kläger unter dauerhaften Schmerzen, insbesondere beim Kauen und Essen. Durch die Fehlverzahnung komme es zu dauerhaften Dysfunktionen, mit Kiefergelenksknacken rechts, einer beginnenden Sklerosierung links sowie einer schmerzhaften Verspannung der Kau- und Nackenmuskulatur. Allenfalls durch eine Aufbissschiene und gegebenenfalls prothetische Veränderung der Bisslage könne das Fortschreiten der Problematik verlangsamt werden. Darüber hinaus stellte der Sachverständige fest, dass sich der Kläger für die bestmögliche Restitution noch in eine aufwändige zahnärztlich-prothetische und/oder kieferorthopädisch-kieferchirurgische Folgebehandlung begeben müsse. Die Dysfunktionen bedürften regelmäßiger künftiger Behandlungen.
Schließlich könnten bei der nachzuvollziehenden Ermittlung der Schmerzensgeldhöhe durch den Senat die Genugtuungsfunktion des Schmerzensgeldes, gegebenenfalls eine Verzögerung der Schadensregulierung durch den Schädiger im Falle eines – jedenfalls nach der durchgeführten Beweisaufnahme – erkennbar begründeten und im Kern eingeräumten Anspruchs im Rahmen einer unerlaubten Handlung berücksichtigt werden (vgl. BGH, Urt. v. 02.12.1966 – VI ZR 88/66, VersR 1967, 256; OLG Saarbrücken, Urt. v. 03.12.2015 – 4 U 157/14, VersR 2017, 698, OLG Hamm, Beschl. v. 22.01.2021 – I-7 U 18/20, RuS 2021, 356; OLG Bremen, Urt. v. 11.07.2011 – 3 U 69/10, NJW-RR 2012, 92; Grunewald, in: Grunewald, BGB, 82. Aufl. 2023, § 253 Rn. 17). Denn bei der Bemessung des Schmerzensgeldanspruches kommt vorliegend der Genugtuungsfunktion – anders als bei einer lediglich fahrlässigen Schadenszufügung – ein besonderer Stellenwert zu (vgl. allg. zu diesem Umstand Grüne-berg, in: Grüneberg, BGB, 82. Aufl. 2023, § 253 Rn. 4). Hiervon ausgehend ist zu-nächst festzustellen, dass der Faustschlag des Beklagten den Kläger jedenfalls so heftig im Gesicht getroffen hat, dass er unstreitig zu Boden gegangen ist. Überdies hat der Kläger durch den Faustschlag einen doppelten Kieferbruch erlitten, der nicht mit konservativen Methoden, sondern nur durch einen operativen Eingriff zu behandeln war. Bei diesem Eingriff sind dem Kläger Platten aus Metall eingesetzt worden, deren Entfernung nicht ohne einen weiteren Eingriff möglich sein wird. Aufgrund der operativen Versorgung des Klägers musste dieser sich in der Vorweihnachtszeit des Jahres 2018 insgesamt eine Woche lang einer stationären Krankenhausbehandlung unterziehen. Hieran schloss sich sodann eine Arbeitsunfähigkeit an, die wiederum zwei Wochen lang dauerte.“