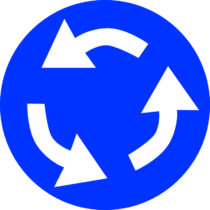Wer Münster kennt, der kennt bestimmt auch den Ludgeriplatz (ganz in der Nähe wohne ich). Der Ludgeriplatz ist ein großer Kreisverkehr. In ihn münden sechs größere Straßen und man kann sich vorstellen, was das – ohne Ampelbetrieb, aber mit regem Auto-, Fußgänger- und Fahrradverkehr – bedeutet: Dreimal am Tag Chaos, nämlich morgens, mittags und abends. Die Stadt Münster bekommt das Verkehrsproblem einfach nicht in den Griff.
Nun dies vorab und als Einleitung zum OLG Düsseldorf, Urt. v. 15.09.2016 – 1 U 195/14 -, in dem es um die Pflichten und die Haftungsverteilung bei einem Verkehrsunfall am/im Kreisverkehr geht. Das OLG hat seiner Entscheidung folgende Leitsätze vorangestellt:
- Das Überfahren der Mittelinsel eines Kreisverkehrs verletzt gerade auch eine Schutznorm zugunsten des einmündenden Verkehrs. Kommt es im unmittelbaren räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dieser Schutznormverletzung zu einem Zusammenstoß, war der Verstoß typischerweise für den Unfall zumindest mitursächlich.
- Erreichen zwei Kraftfahrzeuge gleichzeitig den Kreisverkehr, verstößt der Verkehrsteilnehmer gegen die allgemeine Sorgfaltspflichtanforderung des § 1 Abs. 2 StVO, der sich nicht auf das Fahrzeug im Kreisverkehr vor ihm einstellt und stattdessen mit nicht reduzierter Geschwindigkeit mit anschließender Kollisionsfolge weiterfährt. In einem solchen Fall haftet er für die Unfallfolgen allein.
- Nähern sich Verkehrsteilnehmer aus verschiedenen Richtungen einem Kreisverkehr und besteht bei der Einfahrt die Gefahr, dass sich im Kreisel ihre Bewegungslinien berühren oder gefährlich annähern, gebührt demjenigen Fahrer der Vorrang, der als Erster die Wartelinie erreicht, denn dieser hat die Gelegenheit, als Erster in den Kreisverkehr einzufahren und für sich das Vorfahrtrecht gemäß § 8 Abs. 1 a Satz 1 StVO in Anspruch zu nehmen. Im Kreisverkehr gibt es keinen feststehenden räumlichen Bereich, in welchem die Vorfahrt eines Verkehrsteilnehmers gleichbleibend und unabänderlich geregelt ist. Es kommt nicht darauf an, wer bereits die längere Strecke im Kreisverkehr zurückgelegt hat.
Im Übrigen auch bitte selbst lesen. Lässt sich hier schwer darstellen 🙂 .