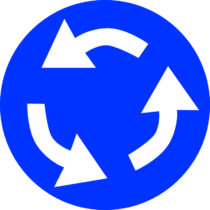Unfallort Münster, Radfahrer, Kreisverkehr und OLG Hamm – das sind vier Merkmale des OLG Hamm, Urt. v. 17.01.2017 – 9 U 22/16 -, die danach schreien, dass das Urteil möglichst bald zu einem Posting hier im Blog führt. Und dem Ruf folge ich 🙂 .
Es geht um einen Radfahrunfall im August 2014 in Münster-Roxel – einem Stadtteil von Münster. Da hatte sich die damals 78 Jahre alte Klägerin aus Münster mit ihrem Fahrrad einer Kreuzung genähert, die in Form eines Rondells angelegt war. Es galt die Vorfahrtsregel „rechts vor links“. Die Klägerin beabsichtigte von der von ihr befahrenen Straße in das Rondell einzufahren und es an der gegenüberliegenden Einmündung zu verlassen, es somit quasi in Geradeausrichtung zu überqueren. Aus der aus Sicht der Klägerin rechts gelegenen Straße näherte sich die Beklagte mit ihrem PKW VW. Beide Fahrzeugführerinnen fuhren in das Rondell und verunfallten.
Die Klägerin zog sich einen schwerwiegenden Bruch des Schienbeinkopfes zu, der aufgrund eines komplikationsreichen Heilungsverlaufes mehrfach operativ versorgt werden musste. Von der Beklagten und dem Haftpflichtversicherer des Fahrzeugs verlangt sie Schadensersatz. Unter Anrechnung vorprozessual gezahlter 4.000 € begehrt sie Ersatz eines materiellen Schadens, insbesondere einen Haushaltsführungsschadens, von noch ca. 4.000 € und ein Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 €.
Das LG hat der Schadensersatzklage überwiegend stattgegeben und der Klägerin ein 20 %-iges Mitverschulden zugerechnet. Auf die Berufung der Beklagten hat das OLG Hamm den Mitverschuldensanteil der Klägerin mit 60 % bemessen und der Klage dem Grunde nach mit einer 40 %-igen Haftungsquote der Beklagten stattgegeben.
In dem Verkehrsunfall habe sich, so das OLG Hamm, die durch ein Verschulden erhöhte Betriebsgefahr des Fahrzeugs der Beklagten, aber auch ein erhebliches Mitverschulden der Klägerin ausgewirkt.
Der Klägerin sei eine Vorfahrtsverletzung anzulasten. Als sie in den Kreuzungsbereich eingefahren sei, habe sie das Fahrzeug der Beklagten als bevorrechtigtes Fahrzeug erkennen können und auch erkannt. Den Vorrang dieses Fahrzeugs habe sie beachten und es vor dem Überqueren der Kreuzung passieren lassen müssen. Vor dem Fahrzeug der Beklagten habe die Klägerin nur dann in die Kreuzung einfahren dürfen, wenn sichergestellt gewesen sei, dass sie die Kreuzung auch vor der vorfahrtsberechtigten Beklagten habe räumen können. Das Unfallereignis zeige, dass dies im vorliegenden Fall nicht gewährleistet gewesen sei. Dass der Beklagten ebenfalls ein Verkehrsverstoß anzulasten sei, entlaste die Klägerin nicht, weil ein vorschriftswidriges Verhalten des Vorfahrtsberechtigten sein Vorfahrtsrecht grundsätzlich nicht entfallen lasse.
Auch die Beklagte treffe – so das OLG – ein gravierendes Verschulden an der Entstehung des Unfalls. Beim Einfahren in das Rondell hab sie das bereits in das Rondell eingefahrene Fahrrad der Klägerin offensichtlich übersehen und daher ihre allgemeine Rücksichtnahmepflicht verletzt. Hätte sie auf die Klägerin geachtet, wäre der Unfall für sie dadurch zu vermeiden gewesen, dass sie ihrer Einfahrt in das Rondell zurückgestellt hätte. Sie sei zwar bevorrechtigt gewesen. Dies gebe ihr aber nicht das Recht, ihr erkennbar durch die Klägerin verletztes Vorfahrtsrecht ohne Rücksicht auf die Klägerin durchzusetzen.
Die Abwägung der beiderseitigen Verursachungs- und Verschuldensbeiträge an der Entstehung des Unfalls hat das OLG mit einer Haftungsquote von 60 % zulasten der Klägerin und von 40 % zulasten der Beklagten bewertet:
„Der Senat bewertet die beiderseitigen Verursachungs- und Verschuldensbeiträge an der Entstehung des Unfalls mit einer Haftungsquote von 60 % zu 40 % zu Lasten der Klägerin. Der Klägerin ist hier mit dem Vorfahrtsverstoß der gravierendere Vorwurf zu machen, denn während die Beklagte zu 1) die allgemeinen Sorgfaltspflichten aus § 1 Abs. 2 StVO zu beobachten hatte, trafen die Klägerin die besonderen Pflichten aus § 8 StVO, die sie sehenden Auges verletzt hat, weil sie in der Annahme, die Kreuzung noch rechtzeitig räumen zu können, trotz des für sie deutlich sichtbaren Fahrzeugs der Beklagten zu 1) in die Kreuzung eingefahren ist. Grundsätzlich trifft den Wartepflichtigen gegenüber dem bevorrechtigten Verkehr ein überwiegendes Verschulden, wobei ein Verschätzen zu Lasten des Wartepflichtigen geht (König a.a.O., Rdn. 68).“