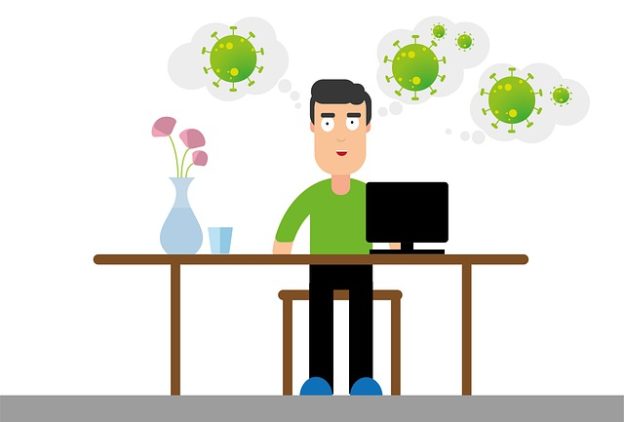© 3dkombinat – Fotolia.de
Heute am RVG-Tag dann zunächst eine Entscheidung zu § 51 RVG. Dazu gibt es ja nicht mehr viele, über die man berichten könnte. Hier ist dann aber mal wieder eine, die ein Posting wert ist. Es handelt sich um den OLG München, Beschl. v. 22.01.2021 – 1 AR 251/20 – 1 AR 266/20, den mir der Kollege Dietrich aus München geschickt hat.
Ergangen ist der Beschluss im Verfahren betreffend das sog. Oktoberfestattentat. Ich erinnere Am 26.09.1980 wurde gegen 22:20 Uhr am Haupteingang der Theresienwiese in München ein Sprengkörper gezündet. Durch die Explosion inmitten der Menschenmenge auf dem Oktoberfest wurden dreizehn Personen getötet, mehr als 200 Menschen erlitten – z.T. schwerste – Verletzungen. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen hatte ein bei dem Anschlag selbst getöteter Attentäter den Sprengsatz gebaut, ihn zum Tatort gebracht und gezündet. Ein vom GBA zunächst geführtes Ermittlungsverfahren wurde mit Verfügung vom 23.11.1982 gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt, nachdem sich der Verdacht weder gegen die dortigen Beschuldigten noch gegen unbekannte Mittäter erhärten ließ. Nachdem die förmliche Wiederaufnahme von Ermittlungen zunächst mit Verfügung vom 5.6.1984 abgelehnt worden war, nahm der GBA mit Verfügung vom 05.12.2014 die Ermittlungen gegen Unbekannt wieder auf. Das Ermittlungsverfahren wurde – nach der Durchführung weiterer, äußerst umfangreicher Ermittlungen – mit Verfügung vom 06.07.2020 erneut gem. § 170 Abs. 2 StPO eingestellt.
Der Kollege ist im Oktober 1982 von mehreren Geschädigten mandatiert worden. Er bestellte sich mit Schriftsatz vom 14.10.1982 gegenüber dem GBA und verfolgte diesem gegenüber in den Folgejahren im Auftrag der Geschädigten das Ziel, die Einstellung der Ermittlungen zu verhindern bzw. ihre Wiederaufnahme zu erreichen. Im Jahr 2008 wurde ihm von den gleichen Geschädigten erneut eine schriftliche Vollmacht erteilt; der Antragsteller zeigte mit Schriftsätzen vom 05.12.2008 und 30.01.2009 gegenüber dem GBA deren Vertretung an – er sei beauftragt „im Lichte neuerer kriminaltechnischer Erkenntnismöglichkeiten sowie sonstiger neuer Informationen (…) eine Wiederaufnahme der Ermittlungen zu erreichen.“ In der Folgezeit korrespondierte er weiterhin mit dem GBA und verschiedenen Institutionen und nahm auch Einsicht in verschiedene Spurenakten, bis er mit Schriftsatz vom 25.09.2014 außerdem die Vertretung weiterer Geschädigter anzeigte und erneut die Wiederaufnahme der Ermittlungen insbesondere die Beiziehung verschiedener näher bezeichneter Akten beantragte, was dann am 05.12.2014 geschah.
Mit Beschlüssen des Ermittlungsrichters beim BGH vom 08.02.2016, vom 09.02.2016 und vom 02.11.2017 wurde der Kollege insgesamt 16 Geschädigten gem. § 406g Abs. 1, 3 Satz 1 Nr. 1 StPO a.F., 406h Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 n.F., § 397a Abs. 1 StPO als Beistand beigeordnet. Der Kollege hat am 28.4./25.5.2016 beim BGH einen Antrag auf Gewährung eines Vorschusses i.H.v. 88.000,- bis 110.000,- EUR auf eine Pauschgebühr beantragt. Der sich der Ermittlungsrichter beim BGH hat sich insoweit für unzuständig erklärt (BGH AGS 2016, 398 = RVGreport 2016, 454). Das OLG hat den Antrag mit Beschluss vom 01.06.2017 zurückgewiesen.
Der Kollege hat nunmehr die Bewilligung einer Pauschgebühr nach § 51 RVG zwischen 130.000,- und 160.000,- EUR beantragt. Die Vertreterin der Bezirksrevisorin hält eine Pauschvergütung in Höhe des Doppelten der Wahlverteidigerhöchstgebühren, welche 1.830,- EUR betragen würden, „zuzüglich eines gewissen Zuschlags im Hinblick auf die Vertretung von 15 Mandanten“ für angemessen. Das OLG hat eine Pauschgebühr von 36.600,– EUR bewilligt.
Das vorab. Hier stelle ich nur zwei Punkte umfangreicher vor. Im Übrigen sagt das OLG: Das Verfahren betreffend die Ermittlungen zum „Oktoberfestattentat“ war sowohl „besonders schwierig“ als auch „besonders umfangreich“ im Sinn des § 51 Abs 1. RVG, was wohl niemand bezweifeln will. Und: Die gesetzlichen Gebühren sind für den bestellten bzw. beigeordneten Rechtsanwalt nicht zumutbar i.S. des § 51 Abs. 1 RVG, wenn sie auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass ihm eine besondere Form der Indienstnahme Privater zu öffentlichen Zwecken abverlangt wird, ein unzumutbares Sonderopfer bedeuten würden,w as das OLG hier m.E. ebenfalls zutreffend bejaht.
Und dann nimmt das OLG noch zu der Frage Stellung, welche Tätigkeiten bei einem Verletztenbeistand für die Gewährung einer Pauschgebühr berücksichtigungsfähig sind, und zur Höhe der Pauschgebühr.
„b) Bei der Bemessung der Pauschvergütung sind jedoch die Tätigkeiten des Antragstellers seit seiner erneuten Vertretungsanzeige vom 05.12.2008 (einschließlich der dafür erforderlichen „Vorarbeiten“ seit 2006) zu berücksichtigen. Die Beiordnung durch den Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vom 08./09.02.2016 wirkte gebührenrechtlich zurück (§ 48 Abs. 6 RVG, vgl. Gerold/Schmidt a.a.O., Rn. 201 zu § 48 RVG); davon sind nach der Auffassung des Senats auch solche Tätigkeiten umfasst, die vor der förmlichen Wiederaufnahme der Ermittlungen mit Verfügung des Generalbundesanwalts vom 05.12.2014 vom Antragsteller mit dem Ziel der Wiederaufnahme unternommen wurden, da jedenfalls seit seiner neuen Bestellung klar war, dass seine nunmehrigen Bemühungen, Anregungen, Anträge, Einlassungen etc. bei der Entscheidung über die Wiedereröffnung des Verfahrens zu berücksichtigen sein würden.
c) Auch sind, wie der Antragsteller zutreffend vorträgt, keinesfalls nur solche Tätigkeiten berücksichtigungsfähig, die den Geschädigten unmittelbar zu Gute kamen, also „Beistand“ im engeren Sinne, z.B. bei der Erlangung von Entschädigung nach dem OEG. Den Geschädigten kam es vielmehr auch und gerade darauf an, die sogenannte „Einzeltäterthese“, die zur Einstellung der Ermittlungen am 23.11.1982 führte, zu hinterfragen. Unabhängig davon, ob sich diese These oder die vermutete Beteiligung Dritter an dem Bombenanschlag nach Jahrzehnten noch erhärten ließen oder nicht, kann es nach Auffassung des Senats den Verletzten im Sinne des Opferschutzes nicht versagt werden, sich in die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft „einzumischen“, um eigene Klarheit über den Hergang des ihnen zugefügten Unrechts zu erlangen. Dass dies dem Willen des Gesetzgebers entspricht, folgt bereits aus dem in § 406e Abs. 1 S. 1 StPO niedergelegten Akteneinsichtsrecht des Verletzten und etlichen weiteren Verletztenrechten, wie dem Recht, als Nebenkläger an der Hauptverhandlung teilzunehmen und dort eigene Rechte wahrzunehmen und gehört zu werden (vgl. § 397 Abs. 1 StPO einschließlich des Beweisantragsrechts aus § 244 Abs. 3 bis 6 StPO sowie des Erklärungsrechts, insbesondere des Rechts zum Schlussvortrag (vgl. §§ 257, 258 StPO).
Der Verletzte soll damit vom Verfahrensobjekt zum Verfahrenssubjekt werden; er hat nicht nur -als ineffektiv erkannte – Defensiv-, sondern „Offensivrechte“ (Anders, ZStW 2012, 374-410, juris). Das damit einhergehende Recht des Verletzten auf „aktive Einflussnahme“ (Anders a.a.O.) auf das Strafverfahren kann nach Auffassung des Senats nicht darauf beschränkt bleiben, sich mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft auseinander zu setzen und sich ggf. nach der Ermittlung des Täters im Strafverfahren einzubringen.
Auch im Lichte des bereits fast 20 Jahre alten Rahmenbeschlusses des Europäischen Rates vom 15.03.2001 über die Stellung von Opfern in Strafverfahren (2001/220/JI, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 82/1), dessen Art. 3 S. 1 lautet: „Die Mitglieder gewährleisten, dass das Opfer im Verfahren gehört werden und Beweismittel liefern kann“ (Hervorhebung Senat), steht für den Senat außer Frage, dass Verletzten im Strafverfahren eine eigene, aktive Rolle zusteht.
Ob und in welchem Umfang der Verletztenbeistand diese Verletztenrechte im Ermittlungsverfahren ausübt, muss – vergleichbar dem Verteidigungsverhalten auf Seiten des Beschuldigten – dem pflichtgemäßen Ermessen des Rechtsanwalts überlassen bleiben. Zwar kann auch im Rahmen der Entscheidung über die Zubilligung einer Pauschgebühr nicht außer Betracht bleiben, ob die jeweils entfaltete anwaltliche Tätigkeit bei objektiver Betrachtung zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung des Mandats tatsächlich geboten bzw. bei Zubilligung eines entsprechenden Ermessens-spielraums zumindest noch als objektiv sinnvoll anzusehende Handlung zur Wahrung der Interessen des Vertretenen anzusehen war (ständige Senatsrechtsprechung, z.B. B. v. 27.09.2016, 1 AR 293/16; so auch OLG Hamm, Beschluss vom 14. Januar 2013 — 111-5 RVGs 108/12 —, juris, m.w.N.). Die umfängliche Tätigkeit des Antragstellers, die auch und gerade Ermittlungstätigkeit war, ist vorliegend angesichts der überaus schwerwiegenden Tat einerseits und der auch aus der Sicht des Senats jedenfalls aus damaliger Sicht nicht völlig fernliegenden Hinweise auf weitere Täter keinesfalls als sachwidrige Wahrnehmung des Mandats anzusehen.
Der Senat ist daher, anders als die Generalbundesanwaltschaft und die Vertreterin der Bezirksrevisorin, der Auffassung, dass auch diejenigen Tätigkeiten des Antragstellers seit dem Jahr 2006, die auf die Aufklärung der Tat vom 26.09.1980 und ihrer Hintergründe zielten, von seiner Beauftragung als Vertreter der Verletzten umfasst waren und gebührenrechtlich ins Gewicht fallen.
d) Die Höhe der festzusetzenden Pauschgebühr kann vorliegend die Wahlverteidigerhöchstgebühren und auch deren Doppeltes überschreiten.
aa) Die Überschreitung der vom Gesetzgeber grundsätzlich für angemessen erachteten Wahl-verteidigerhöchstgebühren bei der Festsetzung einer Pauschvergütung (BT-Drucks. 15/1971 S. 2, 146) kommt zwar nur in extremen Ausnahmefällen in Betracht, denn diesen wird – anders als Pflichtverteidigern – kein Beitrag für das Allgemeinwohl (BVerfG, Beschluss vom 20. März 2007 – 2 BvR 51/07 —, juris) abverlangt. Erforderlich sind daher Umstände, die weit über die – ohnehin schon außergewöhnlichen – Gründe, die zur Festsetzung einer Pauschgebühr berechtigen, hin-ausgehen. Das OLG Bamberg folgert daraus, dass Gebühren oberhalb der Wahlverteidiger-höchstgebühren grundsätzlich gar nicht in Betracht kommen (OLG Bamberg, B. v. 15.12.2015, 10 AR 29/15). Das OLG München will dagegen für Extremfälle, bei denen die Bemühungen des Pflichtverteidigers auch durch die Wahlverteidigerhöchstgebühren nicht mehr in entferntesten abgegolten werden, die Festsetzung einer Pauschgebühr oberhalb dieser Grenze nicht völlig ausschließen (B. v. 21.01.2016, 1 AR 477/15; so auch OLG Nürnberg, B. v. 30.12.2014, 2 AR 36/14, juris). In Betracht kommen insbesondere solche Fälle, in denen die Gebührenordnung – z.B. mangels abrechenbarer Termine – die Tätigkeiten des Anwalts nicht mehr angemessen erfassen kann.
Ein solcher Fall liegt hier vor. Auch die Wahlverteidigerhöchstgebühren i.H.v. 1830,– Euro würden die Anstrengungen des Antragstellers nicht im entferntesten vergüten.
bb) Einer höheren Festsetzung als der doppelten Wahlbeistandsgebühr steht der Rechtsgedanke des § 42 Abs. 1 S. 4 RVG zwar im Grundsatz, aber nicht absolut und immer entgegen, da Wahlbeistände – anders als Pflichtbeistände – eine höhere Vergütung frei vereinbaren und insoweit auf außergewöhnlich umfangreiche Belastungen reagieren können (Senatsbeschluss v. 14.10.2015, 1 AR 367/15, (3-fache Wahlverteidigerhöchstgebühr), Senatsbeschluss 18.10.2019, 1 AR 322/19 (5-fache Wahlverteidigerhöchstgebühr); so auch insoweit überzeugend Gerold/Schmitt, a.a.O. Rn 41 zu § 51 RVG m.w.N.).
Der Senat ist bei der Überschreitung dieser für Wahlverteidiger vom Gesetzgeber errichteten Schwelle zwar äußerst zurückhaltend, da, wie ausgeführt, Wahlverteidiger anders als Pflichtverteidigern nicht von der Allgemeinheit in Anspruch genommen werden und ihnen insoweit grundsätzlich höhere Gebühren als Pflichtverteidigern zustehen – vorliegend würde jedoch auch eine Gebühr von insgesamt 3.660,– Euro dem Antragsteller ein Sonderopfer im Sinne des § 51 Abs. 1 S. 1 RVG auferlegen.
e) Nach ständiger Senatsrechtsprechung (z.B. 1 AR 97/18, B. v. 23.05.2018) kommt eine Berechnung der Pauschgebühr anhand der Arbeitszeit des Rechtsanwalts in Form eines „Stundenlohns“ nicht in Betracht. Die aufgewendete Arbeitszeit ist vielmehr Indiz für Umfang und Schwierigkeit des Verfahrens, nicht unmittelbarer Maßstab für die Entscheidung über die Pauschvergütung (BGH Rpfleger 1996, 169 Rdn. 9 nach juris). Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz will zwar im Gegensatz zur Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung den Zeitaufwand des Rechtsanwalts stärker berücksichtigen. Es hat aber nicht Zeithonorare eingeführt, sondern es grundsätzlich bei Betragsrahmengebühren belassen (vgl. OLG Hamm Beschluss vom 13.03.2013 – 5 RVGs 108/12, Rdn. 19 nach juris) und lediglich bei den Terminsgebühren hinsichtlich der Zeitdauer der Hauptverhandlungstermine Abstufungen eingeführt (zit. OLG Nürnberg, Beschluss vom 30. Dezember 2014 — 2 AR 36/14 —, juris).
Dies vorausgeschickt, kann bei der Bemessung der Pauschgebühr der immense Aufwand, den der Antragsteller angesichts des vorbeschriebenen Umfanges des Verfahrens betrieben hat, nicht außer Acht gelassen werden. Der Senat ist davon überzeugt, dass der Antragsteller fast 1000 Stunden berücksichtigungsfähige Arbeitszeit seit 2008 aufgewendet hat. Er selbst teilt mit, er habe in den Jahren 1982 bis 2006, die der Senat aus vorbezeichneten Gründen für nicht berücksichtigungsfähig hält, insgesamt 410 Stunden aufgewendet. Bringt man diese von den 1382 Stunden in Abzug, die der Antragsteller – ohne weiteres glaubhaft – für seine gesamte Tätigkeit errechnet hat, bleibt ein Arbeitsaufwand, der den Rahmen einer „gewöhnlichen“ Beistandschaft bei weitem sprengt und zur Bewilligung einer großzügigen Pauschvergütung Anlass gibt.
f) Ebenfalls fällt ins Gewicht, dass der Antragsteller schwer traumatisierte Verletzte zu betreuen hatte. Beispielhaft sei auf den Geschädigten pp. verwiesen, der in seiner Mail vom 21.07.2014 die von ihm unmittelbar miterlebte Explosion und deren jahrzehntelangen schweren Folgen für seinen Lebensweg schilderte. Dass Schilderungen wie diese, die bereits beim Lesen erschüttern, den Antragsteller, der sich persönlich um die Geschädigten bemühte, besonders belasteten, bedarf keiner weiteren Begründung. Auch dieser Umstand ist nach ständiger Senatsrechtsprechung gebührenerhöhend zu berücksichtigen (z.B. Senatsbeschluss vom 08.10.2020, 1 AR 128/20).
g) Der Antragsteller war 16 Geschädigten beigeordnet. Auch wenn eine entsprechende Vervielfachung der ihm zustehenden Gebühren nicht in Betracht kommt, ist der mit der Vielfachvertretung verbundene erhöhte Aufwand selbstverständlich bei der Bemessung der Pauschgebühr erhöhend zu berücksichtigen.
h) Schließlich ist zu berücksichtigen, dass das Verfahren, was bereits die Dauer der erneuten Ermittlungen von 5 1/2 Jahren nahe legt, im höchsten Maße kompliziert und verwickelt war. Der Antragsteller hat sich, was der Inhalt seiner zahlreichen Schriftsätze beweist, zum „Experten“ des Oktoberfestattentates entwickelt. Ausweislich dem der Einstellungsverfügung vom 06.07.2020 zu Grunde liegenden Vermerk des Generalbundesanwalts war der Hinweis des Antragstellers auf eine neue Spur („Spur pp.“) der Anlass für die Wiederaufnahme der Ermittlungen……“
Sorry, war ein wenig mehr Text, aber wenn solch ein Beschluss vom OLG München kommt, ist es das wert 🙂 .