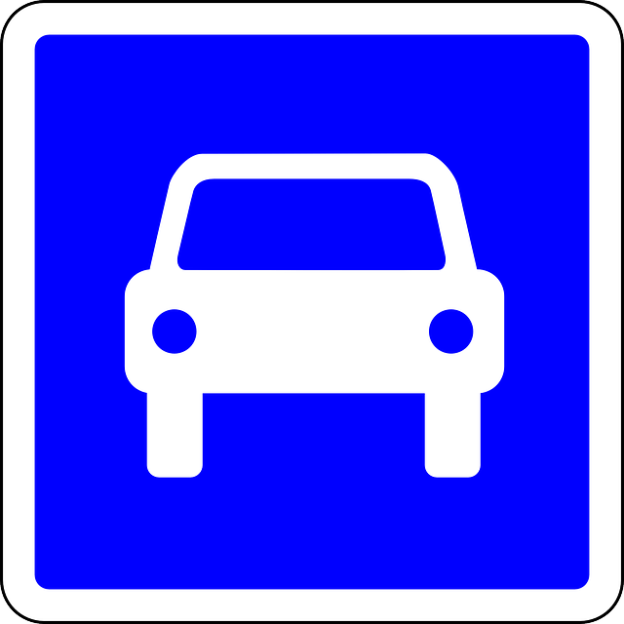Die zweite Entscheidung im „Kessel Buntes“ kommt heute auch vom BGH. Der hatte sich im BGH, Beschl. v. 28.05.2020 – IX ZB 8/18 – mit einer (zivilrechtlichen) Wiedereinsetzungsfrage zu befassen.
Gestritten wird um die Zulässigkeit der Berufung des Beklagten gegen ein OLG-Urteil. Die Berufungsbegründungsfrist war bereits einmal auf Antrag des Klägers bis zum 22.06.2017 verlängert worden. Am 22.06.2017 hat der Beklagte dann eine weitere Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum 30.062017 beantragt. Er hat den Antrag mit einer akuten Erkrankung begründet. Das OLG hat die weitere Fristverlängerung abgelehnt, nachdem der Kläger seine Einwilligung verweigert hatte. Die Verfügung des Vorsitzenden ist dem Beklagten am 19.07.2017 zugestellt worden. Am 24.07.2017 hat der Beklagte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt und die Berufung begründet.
Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags hat der Beklagte einen akuten Erschöpfungszustand angeführt. Er sei deshalb seit dem 21.06.2017 arbeits- sowie verhandlungsunfähig erkrankt und am 22.06. 2017 nicht in der Lage gewesen, die Berufungsbegründung zu erstellen. Die Korrektur und Ausfertigung einer im Entwurf bereits vollständig vorliegenden Berufungsbegründung in einer anderen Sache habe der Beklagte erst nach mehreren Anläufen am späten Abend des 22.06.2017 abschließen können. Das OLG hat den Antrag des Beklagten auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurückgewiesen und seine Berufung als unzulässig verworfen. Dagegen wendet sich der Beklagte mit der Rechtsbeschwerde. Die hatte Erfolg:
„2. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Der Beklagte war ohne sein Verschulden verhindert, die Frist zur Begründung der Berufung einzuhalten (§ 233 Satz 1 ZPO). Auf den rechtzeitig gestellten, mit der Nachholung der Berufungsbegründung verbundenen Antrag (§§ 234, 236 ZPO) ist dem Beklagten deshalb Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.
a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Der Beklagte sei nicht ohne sein Verschulden verhindert gewesen, die Berufungsbegründungsfrist einzuhalten. Der Beklagte habe bereits am 21. Juni 2017 erkennen müssen, dass er aufgrund der Schwere der Krankheitssymptome nicht in der Lage sein werde, die am 22. Juni ablaufende Frist zu wahren. Vor diesem Hintergrund hätten nur zwei Möglichkeiten bestanden. Zum einen hätte der Beklagte den Kläger um Zustimmung zu einer weiteren Fristverlängerung ersuchen können. Zum anderen sei die Beauftragung eines Vertreters mit der Anfertigung der Berufungsbegründung in Betracht gekommen. Hätte der Beklagte bereits am 21. Juni die Zustimmung des Klägers zu einer weiteren Fristverlängerung erbeten, wäre ihm bereits zu diesem Zeitpunkt bekannt geworden, dass eine solche nicht erteilt werden würde. Der Beklagte hätte deshalb bereits am 21. Juni einen Vertreter mit der Anfertigung der Berufungsbegründung beauftragen müssen. Die gleiche Pflicht wäre anzunehmen gewesen, wenn er am 21. Juni noch keine Antwort hinsichtlich einer eventuellen Zustimmung zur Fristverlängerung erhalten gehabt hätte. Die Beauftragung eines Vertreters mit der Anfertigung der Berufungsbegründung habe eine geeignete Maßnahme der Fristwahrung dargestellt. Weder der Umfang noch die Schwierigkeit der Sache ließen die Beauftragung eines Vertreters als ungeeignet erscheinen.
b) Diese Erwägungen halten rechtlicher Nachprüfung nicht stand.
aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs muss ein Rechtsanwalt allgemeine Vorkehrungen dafür treffen, dass die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen auch dann unternommen werden, wenn er unvorhergesehen ausfällt. Er muss seinem Personal die notwendigen allgemeinen Anweisungen für einen solchen Fall geben. Ist er als Einzelanwalt ohne eigenes Personal tätig, muss er ihm zumutbare Vorkehrungen für einen Verhinderungsfall treffen, zum Beispiel durch Absprache mit einem vertretungsbereiten Kollegen (BGH, Beschluss vom 19. Februar 2019 – VI ZB 43/18, NJW-RR 2019, 691 Rn. 7; vom 8. August 2019 – VII ZB 35/17, NJW 2020, 157 Rn. 12). Konkrete Maßnahmen muss der Rechtsanwalt erst dann ergreifen, wenn er den Ausfall vorhersehen kann. Wird er unvorhergesehen krank, muss er deshalb konkret nur das unternehmen, was ihm dann noch möglich und zumutbar ist (BGH, Beschluss vom 27. September 2016 – XI ZB 12/14, NJW-RR 2017, 308 Rn. 9; vom 18. Januar 2018 – V ZB 113/17, V ZB 114/17, NJW 2018, 1691 Rn. 9; vom 8. August 2019, aaO Rn. 12). Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn der Rechtsanwalt die Frist zur Einlegung oder Begründung eines Rechtsmittels bis zum letzten Tag ausschöpft und daher wegen des damit erfahrungsgemäß verbundenen Risikos erhöhte Sorgfalt aufzuwenden hat, um die Einhaltung der Frist sicherzustellen (BGH, Beschluss vom 8. August 2019, aaO Rn. 13).
Allgemeine Vorkehrungen und konkrete Maßnahmen sollen im Verhinderungsfall ineinandergreifen. Wird ein Einzelanwalt unvorhergesehen krank, müssen allgemeine Vorkehrungen dafür getroffen sein, dass die dem erkrankten Rechtsanwalt konkret noch möglichen und zumutbaren Maßnahmen fristwahrende Wirkung entfalten können. Deshalb wird es regelmäßig ein Verschulden des Rechtsanwalts begründen, wenn er aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr in der Lage ist, einen vertretungsbereiten Kollegen zu suchen oder die Suche aufgrund der Kürze der nur noch zur Verfügung stehenden Zeit erfolglos ist (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Februar 2019, aaO Rn. 8). Anders liegt der Fall, wenn sich die im Grundsatz hinreichenden allgemeinen Vorkehrungen im konkreten Fall unvorhersehbar als nicht ausreichend erweisen, etwa deshalb, weil der im Allgemeinen zur Vertretung bereite Kollege selbst verhindert ist.
Auf die allgemeinen Vorkehrungen kommt es nicht an, wenn die dem unvorhersehbar erkrankten Rechtsanwalt konkret noch möglichen und zumutbaren Maßnahmen die Versäumung der Frist auch im Falle sorgfaltsgemäß getroffener allgemeiner Vorkehrungen nicht verhindert hätten (vgl. BGH, Beschluss vom 8. August 2019, aaO Rn. 16). Dies kann anzunehmen sein, wenn die Vornahme der fristwahrenden Handlung durch einen Vertreter unmöglich oder unzumutbar ist und eine Verlängerung der Frist – etwa mangels Einwilligung des Gegners – nicht in Betracht kommt.
bb) Nach diesen Grundsätzen war der Beklagte ohne sein Verschulden verhindert, die Frist zur Begründung der Berufung einzuhalten.
(1) Bei dem Beklagten hat sich am 21. Juni 2017 ein akuter Erschöpfungszustand eingestellt. Der Erschöpfungszustand hat zur Arbeitsunfähigkeit über den 22. Juni – das Datum des Ablaufs der bereits um einen Monat verlängerten Berufungsbegründungsfrist – hinaus geführt. Auf entsprechenden Hinweis des Berufungsgerichts hat der Beklagte ergänzend ausgeführt, dass seine Erkrankung unvorhersehbar gewesen sei.
(2) Vor diesem Hintergrund war der Beklagte gehalten, konkret die Maßnahmen zu ergreifen, die ihm nach Eintritt der Erkrankung noch möglich und zumutbar waren. Möglich und zumutbar war es, einen Antrag auf weitere Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist zu stellen. Dem ist der Beklagte selbst nachgekommen. Der vom Beklagten selbst noch gestellte Fristverlängerungsantrag vermochte die Versäumung der Berufungsbegründungsfrist nicht zu verhindern, weil die weitere Fristverlängerung gemäß § 520 Abs. 2 Satz 2 und 3 ZPO die Einwilligung des Klägers voraussetzte und diese nicht erteilt wurde.
(3) Es war dem Beklagten hingegen nicht möglich und zumutbar, die fristwahrende Anfertigung der Berufungsbegründung durch einen vertretungsbereiten Rechtsanwalt in Auftrag zu geben. Dabei kann offenbleiben, ob mit dem Berufungsgericht davon auszugehen ist, dem Beklagten habe bereits am 21. Juni 2017 klar sein müssen, dass er die Berufungsbegründung krankheitsbedingt nicht fristgemäß würde fertigen können. Dass der Beklagte über die hierzu erforderlichen medizinischen Fachkenntnisse oder jedenfalls entsprechendes Erfahrungswissen verfügte, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Die Beauftragung eines vertretungsbereiten Rechtsanwalts mit der Anfertigung der Berufungsbegründung bis zum Ablauf des 22. Juni 2017 war aber auch dann keine vom Beklagten konkret zu ergreifende Maßnahme, wenn man auf den 21. Juni als Datum der Beauftragung abstellt.
Dem Mandanten des unvorhersehbar erkrankten Rechtsanwalts dürfen aufgrund der Erkrankung keine Nachteile bei der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen entstehen. Gleiches gilt, wenn sich der erkrankte Rechtsanwalt – wie im vorliegenden Fall – selbst vertritt. Die Fertigung einer Rechtsmittelbegründung muss deshalb mit der gleichen Sorgfalt möglich sein, wie ohne die Erkrankung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich ein vertretungsbereiter Kollege des erkrankten Rechtsanwalts regelmäßig zunächst in den Sach- und Streitstand einarbeiten muss und deshalb ein zeitlicher Mehraufwand entsteht. Erschwerend tritt hinzu, dass der vertretungsbereite Dritte auch eigene Mandate zu bearbeiten hat und seine zeitliche Verfügbarkeit demzufolge in der Regel eingeschränkt ist. Vor diesem Hintergrund erfordern die Sorgfaltspflichten des unvorhersehbar erkrankten Rechtsanwalts die Beauftragung eines vertretungsbereiten Kollegen mit der Fertigung einer Rechtsmittelbegründung allenfalls dann, wenn bis zum Ablauf der Begründungsfrist ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Der erforderliche Zeitraum lässt sich nicht abstrakt festlegen. Maßgeblich sind die Umstände des Einzelfalls. Tritt die Erkrankung – wie im Streitfall – erst am Tag vor dem Ablauf der Rechtsmittelfrist zutage, kommt die Beauftragung eines vertretungsbereiten Kollegen mit der Fertigung der Rechtsmittelbegründung nur in einfach gelagerten Fällen in Betracht (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 2009 – II ZB 1/09, NJW 2009, 3037 Rn. 10; vom 8. August 2019 – VII ZB 35/17, NJW 2020, 157 Rn. 16). Um einen solchen Fall geht es hier nicht. Das vom Beklagten mit der Berufung vollständig angefochtene Urteil entscheidet auf 21 Seiten über Klage, Hilfsaufrechnung und Widerklage. Der Sache nach geht es um die rechtliche Aufarbeitung einer gescheiterten Mandatsbeziehung mit mehreren Einzelmandaten und den daraus nach Auffassung der Parteien folgenden wechselseitigen Ansprüchen.“
Betrifft zwar das Zivilrecht, kann aber im Strafverfahren auch Bedeutung haben, wenn dort (ausnahmsweise) das Verschulden des Rechtsanwalts zugerechnet wird.