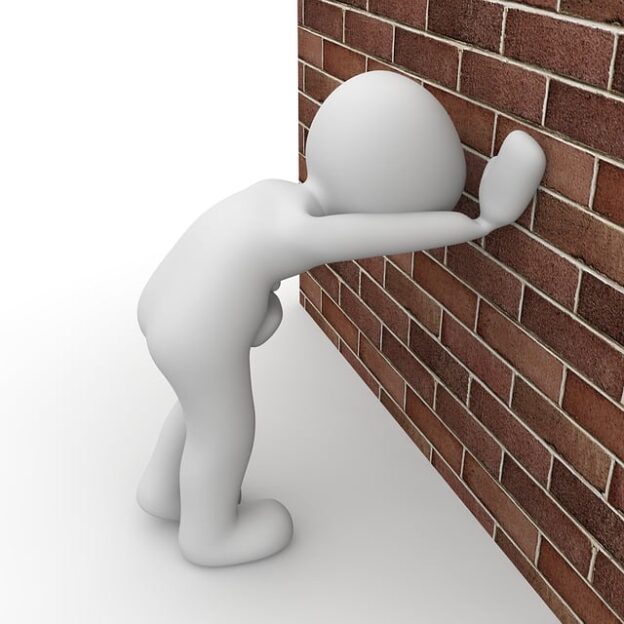Es war zu erwarten, dass es nicht lange dauern würde, bis die ersten Entscheidungen zum neuen KCanG vorliegen würden. Viele Fragen in den gesetzlichen Neuregelung sind ungeklärt und/oder offen. Ich werde über ergehende Entscheidungen hier natürlich berichten, ich habe dafür extra eine neue Kategorie eingerichtet.
Meine Bitte: Wer interessante Entscheidungen erstritten hat, soll mir die bitte zukommen lassen. Am besten als PDF, ich bereite sie dann auf und stelle sie ein. So kann mit der Zeit ein schöner (?) Überblick entstehen.
Und dann: Zu diesem neuen Thema habe ich dann heute gleich zwei Entscheidungen, die ich vorstelle möchte. Die erste kommt mit dem OLG Hamburg, Beschl. v. 09.04.2024 – 5 Ws 19/24 – vom OLG Hamburg. Ergangen ist die Entscheidung in einem Haftbeschwerdeverfahren. Der Angeklagte befindet sich aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des AG Hamburg vom 13.06.2023 seit diesem Tag in Untersuchungshaft in der Untersuchungshaftanstalt Hamburg. Mit dem Haftbefehl wird ihm auf der Grundlage des alten Rechts zur Last gelegt, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gemeinschaftlich unerlaubt Handel getrieben zu haben (§ 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG, § 25 Abs. 2 StGB). Das Amtsgericht Hamburg hat den Haftgrund der Fluchtgefahr (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 StPO) bejaht.
Inzwischen ist der Angeklagte am 04.10.2023 wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge (§ 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG, § 25 Abs. 2 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt worde. Zugleich ist die Fortdauer der Untersuchungshaft aus fortbestehenden Haftgründen nach Maßgabe der Verurteilung angeordnet worden. Nach den Feststellungen des AG handelte der Beschwerdeführer mit 72,01 g Marihuana mit einer Gesamtmenge von 10,21g THC. Strafschärfend ist die festgestellte gewerbsmäßige Begehung berücksichtigt worden.
Das LG hat die Berufungen der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten mit Urteil vom 18.03.2024 verworfen und zugleich den Haftbefehl aufrechterhalten. Der Angeklagte hat Revision eingelegt.
Mit seiner Haftbeschwerde wendet sich der Angeklagte gegen den Haftfortdauerbeschluss. Nach den Neuerungen durch Inkrafttreten des KCanG am 01.04.2024 sei eine deutlich geringere Strafe nach Durchführung des Revisionsverfahrens zu verhängen. Es sei nicht zu erwarten, dass der sich seit über neun Monaten in Untersuchungshaft befindende Angeklagte diesen Zeitraum überschreitenden Freiheitsstrafe verurteilt würde, weshalb die Haftfortdauer unverhältnismäßig sei. Die Haftbeschwerde hatte keinen Erfolg:
„Das haftbefehlsgegenständliche Geschehen erfüllt den Tatbestand des unerlaubten Handels mit Cannabis (§ 34 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 4 KCanG) sowie die für die Annahme eines besonders schweren Falles normierten Regelbeispiele der Gewerbsmäßigkeit (§ 34 Abs. 3 Nr. 1 KCanG) und des Handels mit einer „nicht geringen Menge“ (§ 34 Abs. 3 Nr. 4 KCanG).
aa) Bei Marihuana handelt es sich um ein Produkt der Cannabispflanze, das nach den Begriffsbestimmungen des KCanG als „Cannabis“ erfasst wird (§ 1 Nr. 4 KCanG).
bb) Das vorgeworfene Tatgeschehen stellt sich auch als „Handeltreiben“ im Sinne der Neuregelung dar. Die in § 34 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 4 KCanG gewählte Bezeichnung der Tathandlung als „Handeltreiben“ unterscheidet sich begrifflich nicht von derjenigen des § 29 1 S. 1 Nr. 1, 3. Var. BtMG; auch hinsichtlich des Verbotszwecks sind Unterschiede nicht ersichtlich. Vielmehr handelt es sich insoweit offensichtlich um eine Übernahme des Regelungsregimes des BtMG, so dass die Grundsätze, die von der Rechtsprechung zur Auslegung des Begriffs des Handeltreibens i.S.d. § 29 Abs. 1 S.1 Nr.1 BtMG entwickelt wurden, auf § 2 Abs. 1 Nr. 4 KCanG übertragen werden können (so auch die Regierungsbegründung, vgl. BT-Drs. 20/8794, S. 94).
cc) Entsprechendes gilt für das in § 34 Abs. 3 Nr. 1 KCanG normierte Regelbeispiel der Gewerbsmäßigkeit, so dass auch insoweit davon auszugehen ist, dass gerwerbsmäßig handelt, wer die Absicht hat, sich durch wiederholte Tatbegehung eine fortlaufende Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang zu verschaffen (st. Rspr. zu § 29 3 S. 2 Nr. 1 BtMG, vgl. die Nachweise bei Patzak/Volkmer/Fabricius, BtMG, Rn. 1644 zu § 29 BtMG). Diese Voraussetzungen erfüllt das haftbefehlsgegenständliche Tatgeschehen, insbesondere im Hinblick auf die vorausgegangene Verurteilung wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln vom 22. März 2023 und die vorliegend festgestellten Tatmodalitäten, die beinhalten, dass der Beschwerdeführer und der Mitangeklagte Arslan das Marihuana in insgesamt 54 Gripbeuteln, verteilt auf verschiedene Depots, zum Verkauf bereit hielten.
dd) Zudem ist das in § 34 Abs. 3 Nr. 4 KCanG normierte Regelbeispiel des Handels mit Cannabis in „nicht geringer Menge“ vorliegend erfüllt. Der Gesetzgeber hat dabei von der Möglichkeit, den Begriff der „nicht geringen Menge“ cannabisspezifisch zu definieren, keinen Gebrauch gemacht und hat insbesondere keine Konkretisierung durch einen Grenzwert vorgenommen. Stattdessen hat er die Bestimmung eines solchen Wertes ausdrücklich der Rechtsprechung überlassen (vgl. BT-Drs. 20/8704, S. 132). Der Senat geht davon aus, dass der Grenzwert für die nicht geringe Menge Cannabis – wie zuvor unter dem Regelungsregime des BtMG – bei einer Cannabismenge vorliegt, deren Wirkstoffanteil bei mindestens 7,5 g THC liegt. Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen:
(1) Auch unter Geltung des BtMG war die nähere Bestimmung der „nicht geringen Menge“ der Rechtsprechung überlassen. Diese Bestimmung hat der BGH in seinem Urteil vom 18. Juli 1984 – 3 StR 183/84 (NJW 1985, 1404) dahingehend vorgenommen, dass der Grenzwert bei einer Mindestwirkstoffmenge von 7,5 g THC erreicht ist. Auf einen Vorlagebeschluss des Schleswig-Holsteinischen OLG hat der BGH diese Grenzziehung mit Beschluss vom 20. Dezember 1995 – 3 StR 245/95 (NJW 1996, 794) bestätigt und gegen Einwände verteidigt. Diesen Entscheidungen lag die Erwägung zugrunde, dass der Grenzwert für die „nicht geringe Menge“ eines bestimmten Betäubungsmittels stets in Abhängigkeit von dessen konkreter Wirkungsweise und Intensität festzulegen ist. Maßgeblich ist danach zunächst die äußerst gefährliche, gar tödliche Dosis des Wirkstoffs. Lässt sich eine solche Dosis – wie bei Cannabis – sachverständig nicht oder nicht hinreichend sicher feststellen, so errechnet sich der Grenzwert ausgehend von der Menge einer durchschnittlichen Konsumeinheit eines nicht an den Genuss der Droge gewöhnten Konsumenten als ein Vielfaches dieses Wertes, wobei das Maß der Vervielfachung nach Maßgabe der Gefährlichkeit des Stoffes, insbesondere seines Abhängigkeiten auslösenden oder sonst gesundheitsschädigenden Potentials zu bestimmen ist. Der BGH ist insoweit – sachverständig beraten – davon ausgegangen, dass eine durchschnittliche Konsumeinheit Cannabis bei einer THC-Menge von 15 mg anzusetzen ist. Als Maß der Vervielfachung dieses Wertes hat der BGH in den vorgenannten Entscheidungen den Faktor 500 gewählt, wobei der Wahl dieses Faktors ein Abgleich mit der – als weitaus höher angenommenen und mit dem Faktor 150 bemessenen – Gefährlichkeit von Heroin zugrunde liegt (vgl. im Einzelnen BGH, Urteil vom 18. Juli 1984 – 3 StR 183/84, unter I.1.d) der Urteilsgründe). Dies führt zu einer Menge von 500 x 15 mg, mithin 7,5 g. Soweit der BGH sich zur Bemessung des Faktors der Vervielfachung auf Fragen der Gefährlichkeit gestützt hat, ist er im Anschluss an den Beschluss des BVerfG vom 9. März 1994 – 2 BvL 43/92 (BVerfGE 90, 145 ff.) von Folgendem ausgegangen (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Dezember 1995 – 3 StR 245/95, Rn. 16 bis 18):
„Danach wird eine körperliche Abhängigkeit von Cannabis wohl nicht hervorgerufen; die unmittelbaren gesundheitlichen Schäden bei mäßigem Genuss werden als eher gering angesehen. Jedoch wird die Möglichkeit einer psychischen Abhängigkeit kaum bestritten, wenn auch das Suchtpotential der Cannabisprodukte zu Verhaltensstörungen, Lethargie, Gleichgültigkeit, Angstgefühlen, Realitätsverlust und Depressionen führen; gerade das vermag die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen nachhaltig zu stören. […] Hinzu kommen die durch Cannabisgebrauch für die Sicherheit des Straßenverkehrs entstehenden Gefahren. […] Neben typischen Rauschverläufen werden […] nach gesicherten Erkenntnisses der medizinischen Wissenschaft auch atypische Rauschverläufe beschrieben „mit psychopathologischen Störungen wie z.B. Angst, Panik, innere Unruhe, Verwirrtheit, Halluzinationen, Größenverzerrungen“, […] die also auch schon bei einem einzigen Rausch auftreten können“.
Dieser vom BGH vorgenommenen Grenzziehung für die „nicht geringe Menge“ Cannabis i.R.d. § 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG ist die Instanzrechtsprechung praktisch ausnahmslos gefolgt, so dass bislang von einer insoweit gefestigten Rechtslage ausgegangen werden konnte.
(2) Der Senat sieht keinen Anlass, durch die Neuregelung in § 34 KCanG Veränderungen an dieser Grenzziehung vorzunehmen. Die Regelung in § 34 Abs. 3 Nr. 4 KCanG knüpft hinsichtlich des Wortlauts ohne jegliche Änderungen an die Regelung in § 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG an. Auch das Ziel der Regelung entspricht derjenigen des § 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG. Die Intention des Gesetzes besteht ausweislich der Regierungsbegründung darin, eine kontrollierte und kontrollierbare Qualität der Cannabisprodukte zum Schutz von Konsumenten und so insgesamt einen verbesserten Gesundheitsschutz zu erreichen. Hierzu sollen der illegale Markt eingedämmt sowie die cannabisbezogene Aufklärung und Prävention gleichsam mit dem Kinder- und Jugendschutz gestärkt werden (vgl. BT-Drs. 20/8704, S. 1). Das Ziel der strafschärfenden Berücksichtigung des Handels mit einer nicht geringen Menge Cannabis liege darin, dass hierdurch „insbesondere gefördert wird, dass Cannabis in einem nicht geringen Ausmaß illegal in den Verkehr kommt bzw. in ihm bleibt“. Es geht mithin – wie im Falle des § 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG – um die Verhinderung eines erhöhten Gefahrenpotentials, das sich aus der Ansammlung einer erhöhten (und unkontrollierten) Drogenmenge ergibt (vgl. Patzak/Volkmer/Fabricius, BtMG, Rn. 35 zu § 29a BtMG m.w.N.).
Wohl lässt sich dem Gesetz entnehmen, dass der Gesetzgeber den Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge nunmehr für weniger strafwürdig hält als vormals unter Geltung des § 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG, denn dies folgt bereits daraus, dass die Mindeststrafe von vormals einem Jahr auf nunmehr drei Monate Freiheitsstrafe abgesenkt wurde. Daraus ergeben sich aber keine Folgerungen für die Frage, ab welcher Mengengrenze der Handel mit Cannabis der gegenüber dem Grundtatbestand verschärften Strafandrohung des § 34 Abs. 3 Nr. 4 KCanG unterliegen soll.
Soweit die Gesetzesbegründung die Erwartung an die Rechtsprechung formuliert, dass der konkrete Wert einer nicht geringen Menge „aufgrund der geänderten Risikobewertung zu entwickeln“ sein werde, und dass man „im Lichte der legalisierten Mengen an der bisherigen Definition der nicht geringen Menge nicht mehr festhalten“ könne, der Grenzwert also im Ergebnis „deutlich höher liegen [müsse] als in der Vergangenheit“ (BT-Drs. 20/8704, S. 132), folgt der Senat dem nicht. Die Regierungsbegründung verhält sich nicht klar dazu, worin die „geänderte Risikobewertung“ von Cannabis liegt. Wie oben ausgeführt, beruht die vom BGH vorgenommene Festlegung der Grenze auf 7,5 g THC auf einer bestimmten, auch sachverständig vermittelten Einschätzung der Menge einer Konsumeinheit und der Gefährlichkeit von Cannabis. Dass sich an diesen wissenschaftlichen Grundlagen der Einschätzung etwas geändert hätte, ist weder dem KCanG selbst, noch den zur Auslegung heranzuziehenden Gesetzesmaterialien zu entnehmen. Auf die (unveränderten) Gesundheitsrisiken weist die Regierungsbegründung schließlich auch hin (BT-Drs. 20/8704, S. 68):
„Wie bei anderen psychoaktiven Substanzen auch, ist der Konsum von Cannabis mit gesundheitlichen Risiken, wie beispielsweise cannabisinduzierte Psychosen, verbunden. […] Beim Konsum von Cannabis sind junge Altersgruppen besonderen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Solange die Gehirnentwicklung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kann die Gedächtnisleistung nachhaltig beeinträchtigt werden. Dies gilt insbesondere bei einem früh einsetzenden regelmäßigen Konsum und bei einem Konsum von Cannabis mit einem hohen THC-Gehalt. Zudem bringt regelmäßiger Konsum im jungen Alter besondere gesundheitliche Risiken mit sich“.
Auch „im Lichte der legalisierten Mengen“ (BT-Drs. 20/8704, S. 132) muss der durch den BGH zum BtMG wirkstoffbezogen festgelegte Grenzwert von 7,5 g THC für die „nicht geringe Menge“ an Cannabis nicht geändert, gar erhöht werden, um die mit dem KCanG bezweckte Entkriminalisierung des Besitzes von Cannabis – bis zu einer Menge von 25 g bzw. 50 g Cannabis (§ 3, § 1 Nr. 16 KCanG) – zu erreichen. Soweit argumentiert wird, dass die Grenze zur nicht geringen Menge einen Abstand zu den erlaubten Besitzmengen (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 KCanG) wahren müsse, ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber die vorbenannten Besitzmengen gerade nicht wirkstoffbezogen festgelegt hat. In Anbetracht der vorkommenden Variationsbreite beim Wirkstoffgehalt werden in der Praxis regelmäßig (strafbare) Besitzmengen vorkommen, deren THC-Gehalt den Grenzwert von 7,5 g THC unterschreiten, so dass gegen die hier vorgenommene Grenzziehung nicht eingewandt werden kann, dass der Besitz einer gerade eben strafbaren Menge Cannabis – also geringfügig mehr als 60 g – stets auch das Regelbeispiel des § 34 Abs. 3 Nr. 4 KCanG verwirklicht.
Das KCanG bezweckt zudem lediglich, den Konsumenten zu privilegieren. Demgegenüber bleibt das Handeltreiben mit Cannabis strafbar, ohne dass es hierfür einer Mindestmenge bedarf.
Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass sich die zitierte Erwartung des Gesetzgebers, dass eine Neufestlegung des Grenzwerts geboten sei, die zudem zu einem deutlich höheren Wert führen müsse, keinen hinreichenden Niederschlag im Gesetzeswortlaut gefunden hat. Sie findet sich weder bei der Formulierung des Regelbeispiels des Handels mit einer „nicht geringen Menge“ wieder, noch hat der Gesetzgeber die Kriterien für die Festlegung des Grenzwerts neubestimmt, oder gar einen Grenzwert selbst vorgegeben. Vor diesem Hintergrund erschiene jede Neufestsetzung des Grenzwerts unter Ansatz eines höheren Multiplikators willkürlich. Eine Erhöhung des Grenzwertes liefe dem Ziel, den Markt für illegal gehandelte Cannabisprodukte einzudämmen, zuwider.
4. Es besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO). Fluchtgefahr ist gegeben, wenn bei Würdigung der Umstände des Falles aufgrund bestimmter Tatsachen eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Annahme spricht, der Beschuldigte werde sich – zumindest für eine gewisse Zeit – dem Strafverfahren entziehen, als für die Erwartung, er werde am Verfahren teilnehmen. So liegt es hier. Bereits in der Straferwartung liegt ein erheblicher Anreiz zur Flucht für den Beschwerdeführer, dem mit Blick auf den gemäß § 34 Abs. 3 KCanG eröffneten Strafrahmen von drei Monaten bis zu fünf Jahren (weiterhin) eine Straftat von einigem Gewicht vorgeworfen wird. Dabei wirkt sich erschwerend aus, dass dem Beschwerdeführer die Verwirklichung zweier Regelbeispiele zur Last gelegt wird. Er hat mit einer empfindlichen Freiheitsstrafe zu rechnen, zumal er erst am 22. März 2023 wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln (Kokain) in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten mit Aussetzung zur Bewährung verurteilt worden ist. Die in dem vorgenannten Verfahren erlittene, knapp viermonatige Untersuchungshaft hat den Beschwerdeführer zudem offenbar nicht nachhaltig beeindruckt. Der Fluchtanreiz erhöht sich zudem dadurch, dass der Beschwerdeführer hinsichtlich der Vorverurteilung den Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung zu befürchten hat.
Dem aus der Straferwartung folgenden Fluchtanreiz stehen keine hinreichend belastbaren fluchthemmenden Umstände entgegen. Der recht junge Beschwerdeführer ist ledig, kinderlos und verfügt über keine nennenswerten sozialen Bindungen. Er lebt ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Das Asylverfahren ist eingestellt worden. Nach Auslaufen der Aufenthaltsgestattung bis zum 8. Juni 2023 hat das Amt für Migration auch erst aufgrund der erbetenen Auskunftserteilung an das Landgericht eine Duldung bis zum 27. Mai 2024 erteilt. Ein Interesse an der Legalisierung seines Aufenthaltes hat der Beschwerdeführer eigeninitiativ nicht gezeigt. Im Falle der Haftentlassung ist daher auch eher mit seinem Untertauchen zu rechnen.
5. Vor diesem Hintergrund kann der Zweck der Untersuchungshaft nicht durch weniger einschneidende Maßnahmen erreicht werden (§ 116 StPO).
6. Die Fortdauer der – mittlerweile seit nahezu zehn Monaten vollzogenen – Untersuchungshaft steht nach alledem auch nicht außer Verhältnis zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe (§ 120 Abs. 1 S. 1 StPO). Insbesondere liegt nicht nahe, dass die Dauer der Untersuchungshaft die zu erwartende – unbedingte – Freiheitsstrafe annährend erreicht oder übersteigt.“
1. Man hätte es auch kürzer machen können bzw. man fragt sich, warum das OLG so viel schreibt. Warum hat man es sich nicht einfach gemacht und nur geschrieben: „Was der Gesetzgeber will und möchte, interessiert uns nicht. Es bleibt bei der Festlegung der „geringen Menge“ alles beim Alten.“
Man wird sehen, was der BGH macht, denn auf ihn und seine Entscheidung wird es ankommen. Bis dahin wird es in der Frage ein fröhliches „Hauen und Stechen“ geben.
2. Genau so schlimm finde ich den labidaren Satz des OLG zur Verhältnismäßigkeit. Festgesetzt ist eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten, die sich, da nur der Angeklagte Revision eingelegt hat, nicht mehr erhöhen kann (Stichwort: Verschlechterungsverbot). Davon sind rund 10 Monate bereits in U-Haft „vollstreckt“. Es bleibt also noch eine Reststrafe von maximal sechs Monaten. Und da meint das OLG tatsächlich: „nicht außer Verhältnis zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe“. Wirklich? Irgendwie scheint mir da jedes maß verloren gegangen zu sein. Ich bin froh, dass ich Mitglied in einem solchen Senat nicht bin und auch nicht war.
Im Übrigen ist klar, was mit der Revision des Angeklagten passieren wird. Man wird sie verwerfen.